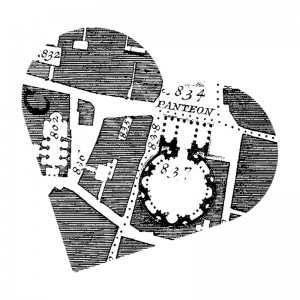Urbane Atmosphären der Liebe
Ein erotisierendes Plädoyer
Die Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre ist gestiegen. Es wird wärmer auf diesem Planeten. Gleichzeitig sehnt sich die Gesellschaft nach mehr Gerechtigkeit und Frieden. Das Zusammenleben in Städten ist dem Anschein nach über die letzten Jahre etwas anstrengender geworden. Die Stadt wird zur Kulisse von Gewalt, sexuellen Übergriffen und Krawallen. Wir sehen Argwohn gegenüber Mitmenschen und die Tendenz zur Versicherheitlichung städtischer Räume. Mehr Kameras, mehr Uniformierte, mehr Zäune, mehr Pfefferspray. Die Atmosphäre wirkt vergiftet. Globale Wärme, so scheint es, trifft auf soziale Kälte: eine gesellschaftliche Situation, deren atmosphärische Aufladung von Gefühlen des Misstrauens, der Missgunst und Angst gekennzeichnet ist.
In diesen Zeiten muss wieder mehr Liebe gewagt werden! Liebe ist die anthropologisch stärkste Form des Zusammenhalts. Im Folgenden wird Liebe, die von der Kraft des Begehrens angetrieben wird, als eine Haltung skizziert und mit Fragen des städtischen Zusammenlebens verbunden. Ziel ist es, aufzuzeigen, dass wir Liebe als politische Praxis begreifen können. Urbanes Zusammenleben ist eine Form affektiver Vergemeinschaftung. Gleichwohl wir mit Blick auf die deutsche Geschichte vorsichtig sein müssen: Zwischen übertriebener Gemeinschaftshitze und klirrender Gesellschaftskälte(1) sollten wir behutsam die angemessene Temperatur finden. Die thermische Regulation in technischer sowie in sozialräumlicher Hinsicht kann als Aufgabe der ArchitektInnen und StadtplanerInnen verstanden werden. Dieser Beitrag plädiert für die Berücksichtigung der Liebe als Lebenskunst in der Planungspraxis.
Liebe und die Erotik urbaner Gemeinschaften
Es ist auffällig, dass wir die stärkste Form der Liebe, die begehrende Liebe, weitgehend zu einem privaten Ereignis gemacht haben. Sloterdijk bezeichnet das Apartment als „Miniatur-Erotop“(2), eine autoerotische Implosion der Liebe. Hiervon gibt es natürlich gesellschaftliche Ausnahmen wie marginalisierte Formen von Liebe – also Formen gegenseitiger Zuwendung, die vom Privaten ausgeschlossen werden(3) – oder eben käufliche Liebe. Wenn wir von einer öffentlichen Ökonomie der Liebe sprechen, so denken wir an Prostitution oder Sexshops. Der Sexshop – in Großbritannien bezeichnenderweise „the private shop“ genannt – handelt mit Illusionen. Er provoziert das Begehren zu konsumieren.(4) Feil geboten werden Simulationen von Beziehung und soziotechnisches Material, welches die Befriedigung von Begierde verheißt. Der Theologe Ward bringt es auf den Punkt, indem er schreibt, dass der Sexshop nichts produziert.(5) Er ist eine endlose Provokation der Begierde zu konsumieren.
Wir sind also auf der Suche nach einem Konzept von Liebe als öffentliche Haltung, welche nicht Nichts produziert. Es gibt unterschiedliche Formen von Liebe, die kulturphilosophisch relevant sind. Vertraut sind die griechischen Begriffe wie philia, die freundschaftliche Liebe, storge, die familiäre Liebe oder agape, die göttliche Liebe. Liebe als eros, die begehrende Liebe, trägt ein starkes Verlangen, eine quasi sexuelle Konnotation in sich. Ich beziehe mich auf Liebe als eros, das heißt auf ‚aus sich herausgehender Liebe’, die den Menschen mit Absicht, mit Intentionen ausstattet, bevor in der Moderne eros begrifflich rein auf die körperlich-sexuelle Ebene bezogen wurde. Liebe als eros umfasst viel mehr Bereiche als lediglich die Sexualität. Eros ist hier nicht als triebhafte Sehnsucht nach Erfüllung eines Mangels gemeint, sondern – in Anknüpfung an Augustinus(6) zum einen und den Philosophen Klages(7) zum anderen – eine preisgebende Liebe, ein Schenken von Fülle, eine bereichernde Lust am Geben.
Das Selbst, das Ich, wird von seinen Beziehungen definiert. Diese Beziehungen entstehen im Modus einer persönlichen Ausrichtung auf etwas. Liebe ist eine „Beziehung der Zuwendung und Zuneigung von etwas oder jemandem zu etwas oder jemandem“(8). Diese Formen der Zuwendung lassen eine Lust am Zusammenleben entstehen.
Begierde, so scheint es, hat immer mit Mangel zu tun. Wir begehren etwas, dass wir nicht haben. Wir lassen uns verführen, um diesen Mangel zu stillen. Dies ist eine verzehrende, man könnte sagen, kannibalische Form des Begehrens. Diese Form der Ökonomie – eine Mangelwirtschaft, wenn man so will – kommt nie zum Stillstand. Der Mangel hört ja niemals auf. Die Verführungsindustrie kann sich auf diese Form des Begehrens verlassen. Die Erfindung von Werbung und Marketing beruht auf diesem Prinzip. In der Überflussgesellschaft, wie der Wirtschaftswissenschaftler Galbraith(9) schon in den 1950ern dargestellt hat, sind alle vorrangigen Bedürfnisse erfüllt, das heißt es müssen psychologisch tieferliegende Begierden angesprochen werden. In diesem Sinne wird Begehren negativ gedacht, da es sich durch Mangel definiert. Definieren wir es stattdessen positiv: Liebe als Fülle! Solch Liebe ist nicht von einem Verlangen nach Stillung eines Mangels getrieben, sondern von großzügiger Freigiebigkeit und sogar von Verschwendung. Es ist eine Ökonomie der Liebe, die nie Verluste macht, sondern ständig Überschüsse produziert. Liebe ist somit etwas, dass nicht weniger wird, wenn man sie schenkt. Es ist eine produktive, exzessive Kraft. Fromm(10) schreibt: „Liebe ist eine Macht, die Liebe erzeugt“. Diese Liebesökonomie entfaltet aufgrund sozialer Nähe ein innovatives Potenzial. Innovation ohne Wettbewerb sozusagen.
Eine Liebesbeziehung begehrt das Beste für das Zugewandte, gibt Leben und gewinnt dadurch selbst. Denn, wie Fromm(11) schreibt: „Indem er gibt, kann er nicht umhin, im anderen etwas zum Leben zu erwecken, und dieses zum Leben Erweckte strahlt zurück auf ihn; wenn jemand wahrhaft gibt, wird er ganz von selbst etwas zurückempfangen.“ Dabei ist Liebe kein magisches Gefühl, welches seinen Ursprung in ontologischen Wolken oder in der romantischen Tiefe eines Herzens hat, sondern eine Lebenskunst(12). Die Kunst des Liebens(13) ist eine schöpferische, zuweilen gar anstrengende Tätigkeit. In dieser Praxis liegt eine Kraft, bei der es sich lohnt, sie in Bezug zum städtischen Zusammenhalt zu denken. Unsere alltägliche Aneignung der Stadt kann als Erotik städtischer Gemeinschaften erfahren werden. Diese Erotik – so eine weitere These – drückt sich räumlich, besser gesagt, gefühlsräumlich, nämlich atmosphärisch aus.
Atmosphärische Räume der Liebe
Das soziale Zusammensein lebt davon, dass wir uns gegenseitig nachahmen, voneinander lernen und kopieren.(14) Beispiele dafür sind modische Trends, kulinarische Geschmäcker, Einrichtungs- und Baustile. Wir schauen uns Dinge ab. Wir geben uns Tipps. Wir inspirieren uns. Am ehesten ahmen wir Gefühle nach. Der Soziologe Tarde(15) beobachtete, dass die Nachahmung der Gefühle der Nachahmung der Ideen vorausgeht. Gefühle sind ansteckend.(16) Schmitz beschreibt diese Form der leiblich-gefühlten Kommunikation mit dem schönen Begriff der „Einleibung“(17). In der Zuwendung zueinander erfahren wir Mitgefühl oder verbinden uns solidarisch im gemeinsamen Antrieb etwas zu tun(18). Wir geraten in den Bann einer gemeinsam geteilten Situation. Wir werden ergriffen von Stimmungen und leben in Atmosphären. Atmosphären sind Ansteckungs- und Nachahmungszonen unserer Erfahrungswelt.
Wir kennen dies von gut gelaunten Sommerabenden unter Freunden. Wir kennen dies, wenn wir von einer feierlichen Atmosphäre auf einem Fest ergriffen werden. Wir kennen dies, wenn wir von der angenehmen oder auch unangenehmen Atmosphäre eines Platzes, eines Quartiers oder einer ganzen Stadt sprechen. Wir kennen dies, wenn wir von einem guten Innovationsklima in einer Region sprechen. Eine Atmosphäre ist insofern ein räumliches Phänomen, als wir sie als räumliche Qualität am eigenen Leib erfahren. Sie entfaltet sich uns in der Erfahrung. Diese sinnliche Erfahrung speist sich aus Elementen der Architektur und Baukultur, des Spiels von Licht und Schatten, der Gerüche, Klänge, den Rhythmen der vielzähligen Bewegungen an einem Ort und natürlich der Anwesenheit Anderer.(19) Aus diesem Amalgam entsteht eine Gefühlserfahrung, die räumlich ergossen als Atmosphäre gespürt wird. Man nimmt oft an, dass Atmosphären nur an besonderen Orten entstehen können oder überhaupt vorhanden sind. Ein schönes Café oder ein romantischer Platz in der Altstadt. Sicherlich variieren Atmosphären in Intensität und Aufdringlichkeit. Wir erinnern zumeist auch nur Atmosphären, von denen wir besonders emotional betroffen waren. Doch wir irren in unserer Neigung, Atmosphären nur mit dem „besonderen Flair“ in Verbindung zu bringen. Alles hat eine Atmosphäre, ob sie aber aufdringlich oder subtil, intensiv oder angenehm ist – das mag variieren. Grundsätzlich kommen wir aus der atmosphärischen „Herumwirklichkeit“(20) nicht heraus.
Sind wir denn Atmosphären vollkommen ausgeliefert? Nein, natürlich nicht. Das Management, also die Praxis des Gestaltens von Atmosphären, gehört zum tätigen Leben des Menschen. Wohnen beispielsweise ist eine kulturelle Praxis der Herstellung und Pflege von Atmosphären.(21) Atmosphären-Management wird überall betrieben: in Gesprächsatmosphären in Therapie- oder Verhandlungszimmern, oder in Gruppen-Atmosphären im Theater, im Gottesdienst oder Schulunterricht. Wir kennen zudem gesellschaftliche Atmosphären: „es liegt etwas in der Luft“, „die Stimmung im Lande kippt“. Dazwischen gibt es weitere Ebenen wie das Quartier, die Stadt oder die Region.(22) Überall lassen sich Atmosphären aufspüren. Diese zu erfassen und unter Umständen neu zu gestalten ist stadt- und sozialpolitische Aufgabe.
Die Erotik urbaner Gemeinschaften entsteht durch und in Atmosphären der Liebe. Atmosphären der Liebe sind also die räumlichen Formen des sozialen Zusammenhalts. Hier können wir erstens zwischen einer Erfahrungsseite auf verschiedenen Maßstabsebenen und zweitens einem gestalterischen Gestus(23) im städtischen Zusammenhang unterscheiden.
Atmosphären der Liebe erfahren wir zunächst in unmittelbaren Begegnungen. Eine liebevolle Umarmung, ein freundlicher Plausch am Kiosk, Momente der Geselligkeit auf der Hundewiese oder am Sportplatz, familiäre Atmosphären der Verbundenheit, Atmosphären von Festgemeinschaften in feierlicher Ekstase oder religiöser Andacht, motivierende Atmosphären von Solidargemeinschaften. Die Liebe kennt räumliche Bezugspunkte. Solche affektiven Geographien sind biographische Wegmarken. Wir können ferner von kollektiven Atmosphären sprechen, die sich spüren und nachvollziehen lassen, auch wenn nicht „alle“ anwesend sind. Stadt-Quartiere haben ihre jeweilige Atmosphäre, das diffuse – und leider oft in politischer Rhetorik so missbrauchte – Heimatgefühl verweist auf Atmosphärisches, in welchem nostalgische Erinnerung und alltägliche Lebenswirklichkeit emotional zusammengebunden werden. Wir scheuen uns nicht, davon zu sprechen, Orte zu lieben, auch wenn diese Topophilie24 meist weniger mit dem Ort an sich als mit unseren fragmentarischen Erinnerungen und Phantasien zu tun hat. Wir haben eine Sehnsucht nach erotischen Gemeinschaften – und diese haben einen klaren Ortsbezug.
Die Erotik städtischer Gemeinschaften besteht zunächst darin, einen räumlichen Ruhepunkt zu finden, der Begegnungen möglich macht. Einen schützenden Ort, der Geborgenheit genauso vermittelt wie er Unwohlsein zulässt. Einen demokratischen Ort, der Streit und Versöhnung ermöglicht. Spektakel und Rückzug. Ungestüme Jugend und gebrechliches Altern. Harmonie und Dissens. Disput und Schweigen. Aufrichtig ausgetragene Konflikte sind das Reinigungsprogramm einer Liebesbeziehung.(25) All diese sozialen Situationen prägen sich atmosphärisch aus und werden leiblich erfahren. Genau diese räumlichen Bedingungen interessieren folglich für eine psychosoziale Stadtentwicklung(26), die atmosphärisch gestaltet.
Wir werden ergriffen von diesen Atmosphären der Liebe. Sie sind ansteckend. Ebenso gestalten wir sie mit. In Atmosphären der Liebe entfaltet sich in vitaler Weise das Zusammenleben. Im Folgenden soll sich der Fokus auf das schöpferische Moment der Planungspraxis richten. Liebe als mitfühlender Gestus und verantwortliche Haltung in Stadt- und Sozialpolitik.
Kann man Liebe planen?
Ist die Liebe denn planbar? Und wenn ja, von wem und für wen? Zunächst: natürlich liebt nicht jeder gleich. Wenn wir über Liebe sprechen, so sprechen wir stets über einen persönlichen Erfahrungskern. Liebe wird unterschiedlich gelebt. Liebe ist nicht immer greifbar und manchmal bringt Liebe in der Praxis vieles durcheinander. Es gibt keine Formel, wie Liebe perfekt funktioniert. Es gibt folglich keine Formel, wie wir sozialen Zusammenhalt perfekt herstellen können. Liebe kann schmerzhaft scheitern. Gleichwohl hindert es uns nicht daran, es immer wieder neu zu versuchen. Und, ja, Liebe – und hier ganz besonders Liebe als eros – ist exklusiv, wenn wir sie nur als unmittelbare, beispielsweise sexuelle Vereinigung denken. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass selbst diese Liebe im Anderen „die ganze Menschheit, alles Lebendige“ liebt.(27) Wir alle kennen die Erfahrung, dass Liebe unseren Weltbezug spürbar verändert.
Liebe als Lebenskunst erfordert konstante Übung. Somit ist Liebe mehr als ein Gefühl. Es ist eine Haltung, die uns erfasst. Rilke schrieb, dass wir die Liebe „ernst nehmen und leiden und wie eine Arbeit lernen“ müssen.(28) Liebe ist immer ein Experiment. Es ist ein Vorschuss, eine Vorleistung. Die Praxis der Liebe ist stark von Improvisation gekennzeichnet. Improvisation wird oft als Mittel der Not, beispielsweise in Zeiten leerer Kassen, angesehen. Wir übersehen dabei, dass Improvisation die hohe Kunst ist, in welcher sich gemachte Erfahrungen, gegenwärtige Zuwendung und unerschütterlicher Glaube an die Zukunft(29) vereinigen.
Die ergreifende Liebe scheint sich einer Planung zu entziehen. Hier hilft uns eine Beobachtung Fromms: „Die Fähigkeit zu lieben erfordert einen Zustand intensiver Wachheit und gesteigerter Vitalität, der nur das Ergebnis einer produktiven und tätigen Orientierung in vielen anderen Lebensbereichen sein kann.“(30) Die Liebe ist nicht untätig. Sie schafft Bedingungen, um sich besser zu verbreiten. Die Kunst des Liebens erfordert ein lebendiges Gespür dafür, wo sie ihre Kraft multiplizierend einsetzt. Mit anderen Worten: wer liebt kann nicht aufhören Pläne zu schmieden seine Liebe weiterzugeben.
Plädoyer für eine liebevolle Stadt- und Sozialpolitik
Wie lässt sich Liebe nun mit Stadtentwicklung zusammenbringen? Was kennzeichnet die Erotik städtischer Gemeinschaften? Wie kann Liebe unser städtisches Zusammenleben für die Zukunft ertüchtigen? Ein kurzes, sicherlich unvollständiges Plädoyer.
Die Ökonomie der Liebe beruht nicht auf Mangel. Im Gegenteil: Liebe ist verschwenderisch. Ein Lob auf die Verschwendung. Diesem Verständnis folgend interessieren Ökonomien der Gabe.(31) Schenkökonomien sind kein Mäzenatentum, das letztlich sich doch selbst im Blick hat, indem es sich ein Mitspracherecht einräumt. Es ist eine Lust, die im Geben liegt. Damit widersetzt sich Liebe den Logiken des Kapitals. Es ist sinnlos, jemanden dafür zu bezahlen, dass er uns aufrichtig liebt. Wenn die Stadt zum Unternehmen wird, dann müssen wir uns nicht wundern, dass die Liebe fehlt. Marx schreibt: „Setze den Menschen als Menschen und sein Verhältnis zur Welt als menschliches voraus, so kannst Du Liebe nur gegen Liebe austauschen.“(32) Dies befreit uns von der Knechtschaft der Effizienz und ermöglicht in ökologischer, ökonomischer und sozialer Hinsicht das produktive Schaffen einer suffizienten Stadt.(33)
Liebe vertraut und gibt keinen Anstoß zum Misstrauen. Dies erfordert Transparenz und Offenheit in unseren Handlungen. Vertrauen ist zu einer „knappen gesellschaftlichen Ressource“(34) geworden. Transparenz und Offenheit werden vermehrt erzwungen. Der öffentliche Raum wird durch Kontrollen eingeschnürt. Bewegungsspielräume werden im Namen der Sicherheit eingeschränkt. Wir sind selbst zu Sensoren geworden. Wir haben uns an Überwachung gewöhnt, an die Vernichtung klandestiner Nischen, an Architekturen der Durchleuchtung. Wir leben vermeintlich stets im Möglichkeitsraum des Hasses und Terrors. Liebe muss sich hier mutig Räume zurückerobern.
Liebe ist ein Experiment. Sie erfordert eben Mut, lässt sich durch Scheitern nicht grundsätzlich in Frage stellen. Es gibt keine Rezepte für Erfolg in Liebesdingen. Mit Kreativität, Humor und Selbstironie werden stets neue Kräfte mobilisiert. Liebe improvisiert ständig. Liebe hat etwas Spielerisches. Der potentielle Raum des gemeinsamen Spiels und des künstlerischen Ausdrucks ermöglicht es, Weltbezug zu erproben und herzustellen.(35) Liebe benötigt spielerische Freiräume.
Liebe hat ein anarchisches Moment. Sie lässt sich nicht beherrschen oder regulieren. Sie wächst organisch. Es gibt keine Hierarchien, auch wenn es immer wieder kurzzeitig stabile Machtverhältnisse gibt. Aber Macht bleibt flüssig. Es ist eine demokratische Form der Macht. Liebe hat den Wunsch, Abhängigkeiten aufzulösen. „Die Liebe“, so Fromm(36), „ist das Kind der Freiheit, niemals das der Beherrschung.“ In Atmosphären der Liebe werden allzu eindeutige Zuschreibungen vermieden. Es wird zur Selbstgestaltung der Welt angeregt. Stets werden neue Formen der Teilhabe ausgehandelt. Regeln sind nie das Ende einer Aushandlung, sondern eine vorläufige Einigung. Ferner duldet Liebe auch Ablehnung, Dissens und bleibt dabei grenzenlos.
Liebe kennt ästhetische Formen. Schönheit entsteht durch Bejahung. Tatsächlich entsteht hieraus eine Form der ästhetischen Ethik. Die Wertschätzung des Anderen gelingt wechselseitig durch Bejahung. Dabei ist Liebe progressiv und nicht nostalgisch.(37) Der Umgang mit Atmosphären erfordert eine ästhetische Schulung.(38) Liebe ist eine Kunst, und wer darin ein Meister oder eine Meisterin werden will, benötigt Disziplin, Konzentration, Geduld und Kreativität.(39) Der Zauber der Liebeskunst führt Menschen zusammen, die „ohne Poesie im öffentlichen Raum isoliert geblieben wären“.(40)
Liebe hat ein ethisches Moment. Es ist, wie Schmid(41) herausgearbeitet hat, eine kommunikative Ethik. Das gemeinsam zu Bejahende muss ausgehandelt werden. Solch eine Erotik städtischer Gemeinschaften ist gekennzeichnet von der Bereitschaft, den Anderen wertzuschätzen, ihn zu bejahen, ihn nicht zu konsumieren, sondern in seiner Weise stehen zu lassen. Die damit entstehende Ethik der Liebe macht eine Wechselseitigkeit der Wertschätzung möglich.(42) Architektur und Stadtplanung können sozialpolitische Aufgaben nicht im Alleingang lösen, aber sie können materielle Bedingungen für Gerechtigkeit schaffen.
Ohne Liebe kann es keinen Zusammenhalt geben. Dies fängt im direkten Umgang an, zieht sich durch die Nachbarschaft, überschreitet Grenzen und wird global. Angesichts der planetarischen Herausforderungen können wir nicht allein unser Heil in der Technologie suchen, uns in heimelige Identitäten hineinphantasieren oder auf die große Revolution warten. Wir können aber unser Herz in die Hand nehmen und kleine Republiken der Liebe in uns und um uns herum gründen. Liebe ist das Fundament sozialer Gerechtigkeit. Sie ist eine stadt- und sozialpolitische Verantwortung, die hier und jetzt beginnt.
Dr. Simon Runkel studierte Geographie, Friedens- und Konfliktforschung, Psychologie und Kunstgeschichte in Marburg, Los Angeles und Bonn. 2015 wurde er an der Universität Bonn zum Thema „Crowd Management“ promoviert. Seit 2015 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Geographischen Institut der Universität Heidelberg. Runkel forscht im Bereich der kritischen Humangeographie zu Fragen der Räumlichkeit des gesellschaftspolitischen Zusammenlebens.
21. Berliner Gespräch 2016: Simon Runkel from BDA Bund Deutscher Architekten on Vimeo.
Anmerkungen
1 Vgl. Lethen, Helmut: Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen, Frankfurt / Main 1994.
2 Sloterdijk, Peter: Sphären. Plurale Sphärologie – Band III. Schäume, Frankfurt / Main 2004, S. 599.
3 Bell, David / Valentine, Gill (Hrsg.): Mapping Desire, London 1995.
4 Ward, Graham: Cities of God.
London / New York 2000, S. 119 f.
5 Ebda., S. 120.
6 Ebda., S. 76 f.
7 Klages, Ludwig: Vom kosmogonischen Eros, München 1922.
8 Schmid, Wilhelm: Die Liebe atmen lassen, Berlin 2013, S. 52.
9 Galbraith, John Kenneth: The Affluent Society, Boston 1998, S. 117.
10 Fromm, Erich: Die Kunst des Liebens, Frankfurt / Main 1980. S. 35.
11 Ebda.
12 Schmid, 2013.
13 Fromm, 1980.
14 Nussbaum, Martha: Politische Emotionen, Berlin 2016, S. 227.
15 Tarde, Gabriel de: Die Gesetze der Nachahmung, Frankfurt / Main 2009, S. 212 ff.
16 Nussbaum, 2016, S. 227.
17 Schmitz, Hermann: Atmosphären, Freiburg 2014, S. 56.
18 Ebda., S. 18.
19 Hasse, Jürgen: Atmosphären der Stadt. Aufgespürte Räume, Berlin 2012. S. 20.
20 Dürckheim, Karlfried Graf von: Einleitendes zur Untersuchung des gelebten Raums, in: Hasse, Jürgen / Kozljanic, Robert J.
(Hrsg.): Gelebter, erfahrener und erinnerter Raum, München 2010, S. 32.
21 Vgl. Schmitz, Hermann: Der Leib, der Raum und die Gefühle, Bielefeld 2009, S. 77; Schmid, 2013, S. 331.
22 Hasse, 2012.
23 Vgl. Brecht, Bertold: Kleines Organon für das Theater, Frankfurt / Main 1960.
24 Tuan, Yi-Fu: Topophilia, New York 1990.
25 Fromm, 1980, S. 115.
26 Vgl. Jüngst, Peter: Psychodynamik und Stadtgestaltung, Stuttgart 1995.
27 Fromm, 1980, S. 67.
28 Rilke, Rainer Maria, 1904, zit. in Schmid, 2013, S. 214.
29 Fromm, 1980, S. 133 ff.
30 Ebda., S. 141.
31 Mauss, Marcel: Die Gabe: Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften, Frankfurt / Main 2009; Hyde, Lewis: The Gift: Imagination and the Erotic Life of Property, New York 1983; Schmid, 2013, S. 228 ff.
32 Marx 1971, zit. in Fromm, 1980, S. 35.
33 Sachs, Wolfgang: Die vier E’s: Merkposten für einen maßvollen Wirtschaftsstil, in: Politische Ökologie, Nr. 33, 1993, S. 69-72; Paech, Niko: Befreiung vom Überfluss. Auf dem Weg in die Postwachstumsökonomie, München 2012.
34 Schmid, 2013, S. 135.
35 Nussbaum, 2016, S. 273 f.
36 Fromm, 1980, S. 39.
37 Liebe lässt sich nicht simulieren. In den letzten Dekaden hat die aufwendige Renovierung von Altstädten den Eindruck erweckt, dass wir in Zeiten der Höchstgeschwindigkeitsglobalisierung die Geborgenheit aus der Vergangenheit zu importieren versuchten – vgl. Jüngst, 1995, S. 145 ff.
38 Schiller, Friedrich: Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, in: Schillers Werke in zwei Bänden, 2. Band, München 1958, S. 563-641; Düttmann, Susanne: Ästhetische Lernprozesse. Annäherungen an atmosphärische Wahrnehmungen von LernRäumen, Marburg 2000; Böhme, Gernot: Atmosphäre. Essays zur neuen Ästhetik, Berlin 2013.
39 vgl. Fromm, 1980, S. 119.
40 Nussbaum, 2016, S. 582.
41 Schmid, 2013.
42 Ebda., S. 222 f.