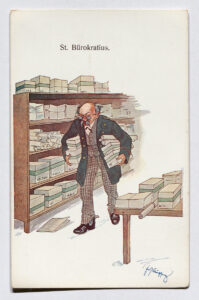Verheißungen der Einfachheit
Warum ist „Bürokratie“ bis heute ein Feindbild – obwohl sie als Grundlage des Rechtsstaats gilt? Die Rechtswissenschaftlerin Pascale Cancik geht in ihrem Text der erstaunlichen Karriere eines politischen Schimpfworts nach: Sie zeigt, wie der Begriff „Bürokratie“ seit dem 18. Jahrhundert als Projektionsfläche für ganz unterschiedliche Kritik dient – mal liberal, mal konservativ, mal wirtschaftsnah. Mit Blick auf Geschichte, Sprache und Recht analysiert sie die widersprüchliche Funktion von Bürokratiekritik und erläutert, warum gerade das Streben nach Vereinfachung oft neue Komplexität erzeugt.
Am Anfang steht eine Verwunderung. Bekanntlich, das wissen wir immerhin von Max Weber,(1) bezeichnet Bürokratie denjenigen Typus von Verwaltung, der den Rechtsstaat vom Obrigkeitsstaat unterscheidet. Bürokratische Verwaltung ist regelgebunden, also nicht willkürlich. Sie verfährt schriftlich, also kontrollierbar etwa durch Gerichte. Sie wird ausgeübt durch Amtsträger, die nach Leistung und Eignung ausgewählt werden, also nicht aufgrund von Familiendynastie oder Ämterkauf. Sie kennt Lebenszeitbeamte, die mit sicherer Besoldung und Amtsethos ausgestattet, also nicht auf Korruption angewiesen und durch Entlassungsdrohung gefährdet sind. Im demokratischen Rechtsstaat schließlich werden die Regelungen, die jene Verwaltung anleiten, von einem Parlament der Bürger und Bürgerinnen erlassen, also nicht von absolutistischen Monarchen.
Man mag sich also wundern, weshalb wir seit fünfzig Jahren über Bürokratieabbau debattieren. Woher kommen all die Bürokratiemonster, die regelmäßig von Rittern der Entbürokratisierung bekämpft werden müssen? Hat sich die gute Bürokratie wirklich so verändert?
Eine Antwort finden wir im Ancien Régime vor der Französischen Revolution. Mitte des 18. Jahrhunderts nämlich erfindet der Kaufmann und hohe Handelsbeamte Vincent de Gournay nicht die Sache, aber das Wort: bureaucratie.(2) Er verspottet mit dieser Sprachschöpfung eine übermäßige Einmischung des absolutistischen Staates in den Handel und formuliert damit eine gewissermaßen wirtschaftsliberale Kritik avant la lettre, manchmal spricht er auch von bureaumanie.
Am Anfang also steht ein Spott- und Schimpfwort, die Bezeichnung für etwas Pathologisches, eine Krankheit. Bürokratie ist ausschließlich negativ. Die nächste Verwunderung folgt auf dem Fuß: Wie kann ein politisches Spottwort so viele politische Systemwechsel überleben?
Entbürokratisierung als heroisches Narrativ
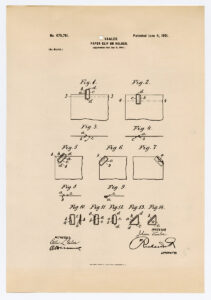
Auszug aus dem Patentantrag für eine Büroklammer von Johan Vaaler, 1901, Foto: U.S. National Archives (gemeinfrei)
Im Deutschland des Vormärz mutiert Bureaukratie, wie es jetzt heißt, zum Kritikwort unter anderem liberaler und frühdemokratischer Kritik am monarchischen Obrigkeitsstaat. Nicht zuletzt das Beamtentum, das aus Bürgern Untertanen macht, verkörpert diese Bürokratie. Die tintenklecksende, überförmliche, engstirnige, unfähige Macht der Bureaukraten und mit ihnen verbunden die übermäßige „Ausdehnung des Staates“(3) steht im Zentrum jener emanzipativen Kritik im 19. Jahrhundert. Es geht gegen die „Schreibstubenherrschelei“, wie eine zeitgenössische Übersetzung von „Bureaukratie“ lautet. Der emanzipative Ansatz, und das ist wichtig, geht über Fragen der Wirtschaft bei weitem hinaus. Es geht um gesellschaftliche Freiheit und Selbstbestimmung, und später gegen die Bureaukratisierung allen Lebens.(4) Schon damals nutzen die unterschiedlichsten Interessen und Positionen das gleiche Wort. Höchst unwahrscheinlich, dass sie Gleiches damit meinten.
„Bürokratie“ markiert ein Herrschafts-Unbehagen, fungiert als Gegenkonzept, als das von liberalen, demokratischen, aber auch kirchlichen Kräften zu Überwindende. Diese Funktion als etwas zu Überwindendes hat der Begriff ebenso wenig verloren wie seine Vagheit – trotz Max Weber und der organisationswissenschaftlichen Forschung, trotz erheblicher politischer und gesellschaftlicher Systemwechsel. Der mit dem Stigmawort „Bürokratie“ verbundene Appell an die menschliche Sehnsucht nach Freiheit und Selbstbestimmung, nach Einfachheit, Mündlichkeit, Verständlichkeit, funktioniert offensichtlich auch heute noch, obwohl der monarchische Obrigkeitsstaat mit seinen Untertanen doch recht weit weg ist. Die Karriere der „Ent-Bürokratisierung“ weist es aus.
In den 1970er-Jahren beginnt eine neue Phase: Prägend werden die Worte „Bürokratieabbau“ und „Entbürokratisierung“. „Bürokratie“ wird zum parteipolitischen Wettbewerbsbegriff gemacht. Die Rettung der „Gesellschaft in Fesseln“ vor jener Bürokratie wird zum Projekt, zunächst der CDU. Zu diesem rhetorisch-praktischen Projekt gehört auch der Begriff „Bürokratie-Kosten“, der in den 1980er-Jahren erfunden wird. Hinter der „gefesselten Gesellschaft“ verbirgt sich nun im Wesentlichen die Wirtschaft. Der gerade auch kapitalismus- und wirtschaftskritische Anteil früherer Bürokratie- und Bürokratisierungskritik wird in den folgenden Jahrzehnten nahezu in Vergessenheit geraten.(5) Versuche der damaligen FDP und der SPD, die tatsächlichen Probleme anzugehen, ohne die Ressentiment-geprägte Diffamierung des Bürokratiebegriffs zu übernehmen – etwa mit der Zielvorstellung: „bürgernahe Verwaltung“ – können die Bürokratierhetorik nicht verdrängen.
Von den Parteiprogrammen wandert die Entbürokratisierung in die Staatspraxis. Die Bürokratiekritik, einst gesellschaftliche Kritik am Staat, wandelt sich gewissermaßen zur Staatsaufgabe im „schlanken Staat“. Nach einer ersten Runde des Bürokratieabbaus in Bund- und Länderkommissionen folgt in den 1990er-Jahren eine erneute Welle schärferer Kritik. Gegen vermeintlich zu viel Staat und Staatsverschuldung sollen helfen: Entbürokratisierung, Privatisierung, Deregulierung.
Im Rahmen des nun prägend gewordenen wirtschaftsliberalen Diskurses markiert das Wort Bürokratie vorwiegend Rechtskritik. Im Zentrum steht eine als problematisch wahrgenommene Regulierung der Wirtschaft. Die „Zuviel-Recht-Behauptung“ bezieht sich vorwiegend auf bestimmte Rechtsgebiete, aufgelistet etwa im Handbuch „Entbürokratisierung von A bis Z“.(6) Zu entbürokratisieren sind „Rechtsmaterien, die administrativ zu bewältigende Restriktionen beinhalten und damit mehr hemmen als fördern. Ungezählte Ge- und Verbote im Wettbewerbs-, Bau- und Planungs-, Sozial-, Steuer- und Vergaberecht (…).“
Die Auflistung zeigt, worum es dieser Bürokratiekritik geht: Wirtschaftsförderung. Das ist ein legitimes und wichtiges Anliegen, die Debatten darum aber sind verunklarend, wenn nur die Kosten ungewollter Regelungen thematisiert, ihr Nutzen aber unterschlagen wird, wie das häufig der Fall ist.
Bis heute appelliert die Entbürokratisierungsrhetorik an unser kollektives Wissen. Ein Wissen, das nicht selten kollektives Ressentiment ist, wonach Bürokratie doch irgendwie schlecht und unbürokratische Hilfe irgendwie gut sei. Es wird gespeist aus politischer und medialer Rhetorik, professionellen Meinungsumfragen,(7) Gurkenkrümmungssatiren und wissenschaftlichen Analysen.
Wie wir sprechen, zeigt uns etwa die Datenbank Deutscher Wortschatz. Sie listet als „Synonym“ für Bürokratie auf: „Administration, Pingeligkeit, Bürokratismus, Kleinlichkeit, Pedanterie, Kleinkariertheit, Papierkram, Amtsschimmel, Engstirnigkeit, Papierkrieg.“(8)
Das ist noch niedlich verglichen mit medizinischen Konnotationen wie Wuchern, Ersticken oder, im psychotherapeutisch aufgeklärten 21. Jahrhundert, „Bürokratie-Burnout“; und es ist noch harmlos verglichen mit den verbreiteten fesselungs- und flutapokalyptischen Formulierungen der vergangenen Jahrzehnte. Solche rhetorischen Rahmungen ermöglichen die Inszenierung von Entbürokratisierung als heroischen Akt. Politiker, notwendig die Hauptverursacher von Recht und „Bürokratie“, gerieren sich als Helden der Entbürokratisierung: take back control. Zugleich distanzieren sie sich gewissermaßen von sich selbst. Das gelingt besonders gut, wenn das „Bürokratiemonster“ aus Europa kommt, jenem fernen System, mit dem „wir“ nichts zu tun haben.
Bürokratie also ist ein vager Begriff. Er lässt an Vieles denken, ist anfüllbar mit allem, was die Adressaten an Staats-, Verwaltungs- und Rechts-Unbehagen gerade so bewegt. Um mit Adorno zu sprechen: „Die Bürokratie ist der Sündenbock der verwalteten Welt“.(9) Bürokratie ist zum zweiten ein Stigmawort. Es funktioniert als Angebot zur negativen Sinnstiftung, zur Abgrenzung von irgendwie Ungewolltem. Die Unbestimmtheit des semantischen Potenzials macht seine Attraktivität im politischen Diskurs aus. Das kann man besonders gut an der Entbürokratisierungsrhetorik sehen. Wenn Bürokratie das Ungewollte bezeichnet, muss Bürokratieabbau ja wohl etwas Gutes sein.
Vagheit und kollektiv aktivierbares Ressentiment lenken ab von eigentlich zu führenden Sachdiskussionen: Welche staatlichen Aufgaben und Regelungen wollen wir und zu welchen Kosten? Gegebenenfalls ermöglicht Entbürokratisierungsrhetorik sogar Entscheidungen, die in einem anderen, seriösen Kommunikationsrahmen womöglich nicht vermittelbar wären. Schließlich betreffen gegenwärtige Vorschläge zum Bürokratieabbau regelmäßig gesellschaftlich hochrelevante Themen: Gesundheitsschutz, Umweltschutz, Datenschutz, Arbeitsschutz, Verbraucherschutz, Steuereinnahmenschutz.
Aber das Baurecht …
(über)kompliziertes Recht?
Nun handelt es sich aber natürlich nicht nur um Diskurs und unreflektiertes oder gar manipulatives Framing. Es gibt eine „wirkliche Wirklichkeit“, berechtigtes Unbehagen und jede Menge Probleme. Das Bürokratieproblem-Panorama erstreckt sich über die Themenfelder: Personal, Interaktion mit Bürgern und Bürgerinnen sowie Unternehmen (Formulare, Verfahren, Verhalten, Kommunikation); Organisation / Effizienz und nicht zuletzt: Recht und Regulierung.
Die Wahrnehmung, dass das Recht zunehme und immer komplizierter werde, ist nicht neu. Jede Modernekritik, vermutlich sogar die vormoderne, pflegt wohl ein eigenes Komplexitätsunbehagen. Aber zurück zum Recht. Als überkompliziert gilt unter anderem das Baurecht. Ob es sich im Komplexitätswettbewerb gegen das Umwelt-, Lebensmittel- oder Düngerecht wirklich durchsetzen würde, ist fraglich. Dass etwas geschehen muss, scheint aber unstrittig – und es geschieht ja auch schon immer etwas. Wir kommen darauf zurück.
In den 1970er-Jahren werden entsprechende Entwicklungen sowie damit verbundene Überlastungen, nicht zuletzt der Verwaltungen, unter dem Stichwort „Verrechtlichung“ und „Kosten des Rechtsstaats“ wissenschaftlich analysiert. Wenig überraschend gibt es ein komplexes Bündel von Gründen für die Komplexität des als kompliziert beschreibbaren Rechts. Zu den Faktoren gehören neben dem föderalen System unter anderem schlicht komplexe Sachverhalte, wie etwa Technikentwicklungen. Sie sind einfach nicht einfach und also auch nicht einfach zu regulieren. Überfordernde Steuerungserwartungen der Politik einerseits, Über-Erwartungen der Gesellschaft andererseits spielen eine wichtige Rolle. Jeder „Skandal“ führt zum Ruf nach mehr oder schärferen Regelungen – obwohl nicht selten eine bessere Anwendung existierender Regelungen ausreichend, vielleicht gar zielführender wären. Schließlich führt die langjährige Verdrängung negativer Folgen unserer Wirtschafts- und Lebensweise zu Problemen, deren Lösung auch über neues Recht erfolgt: Klimawandelinduzierte Wasserknappheit und Wassergefahren etwa fordern neue Überlegungen zu Rationierung und Katastrophenschutz, nicht zuletzt im Städtebau, die in Recht und Organisation übersetzt werden. Pandemiebewältigung ohne Recht scheint schwerlich denkbar.
Noch kaum debattiert wird hingegen die Frage, ob es auch ein spezifischer Typus von Recht ist, der sich als Komplexitätstreiber erweist: das sogenannte Regulierungsrecht. Seit den 1990er-Jahren hat sich jener Begriff Regulierung durchgesetzt. Bei aller Unklarheit bezeichnet er insbesondere die rechtliche Begleitung und Steuerung der sogenannten Liberalisierung durch Privatisierung und Deregulierung, also der Eröffnung von Märkten für Leistungen, die vordem oft staatlich oder im Oligopol erbracht wurden. Telekommunikation, Post oder Energieversorgung bieten Beispiele.
Dass die Deregulierung, einst von einigen als Heilsbringer gelobt, zu Re-Regulierung führen kann, ist mittlerweile ein unstrittiger Befund. Als anerkannt dürfte auch gelten, dass jene Re-Regulierung oder schlichter: dasjenige Recht, welches die wettbewerbliche Aufgabenerfüllung rahmt, notwendige Folge von Privatisierungen ist, jedenfalls dann, wenn der Staat die Aufgabe der Daseinsvorsorge nicht aufgibt. Wir sprechen von der verfassungsrechtlichen Gewährleistungsverantwortung des Staates, der die Aufgabenerfüllung abgeben kann, sie aber sicherstellen muss. Ähnliches gilt, jenseits der Daseinsvorsorge, auch für andere Formen marktförmiger Aufgabenerledigung, wenn also auf ökonomische Instrumente oder Wettbewerbslösungen gesetzt wird, nicht auf direkte staatliche Ver- oder Gebote und Zuweisungen. Gerade diese neuen „Steuerungsinstrumente“ sind verbunden mit Berichtspflichten, die Informationsasymmetrien zwischen Privaten und Staat überbrücken und dem Nachweis dienen, dass die Privaten ihre Aufgaben zureichend erfüllen – also etwa kein Preisdumping betreiben, keine Wettbewerbsverzerrung et cetera. Märkte sind komplexe Veranstaltungen, also ist es ihre rechtliche Herstellung und Begleitung auch. Der Emissionshandel bietet ein anschauliches Beispiel. Aber auch die Steuerung durch (wettbewerbliche) Projektförderung, die immer weiter ausgedehnt worden ist, führt vor allem zu einem: mehr Anträge, mehr Berichte.
Die Entwicklung dieser Art von Recht ist eng verbunden mit der Entstaatlichung und Entbürokratisierung seit den 1990er-Jahren. Man würde es wohl als Ironie der Geschichte bezeichnen können, wenn gerade dieser Rechtstypus sich nun als Teil des mit Bürokratie markierten Rechtsproblems erweisen sollte. Ob dem so ist, bedürfte vertiefter Analyse. Und auch wenn dem so wäre, wäre der Weg zu mehr Einfachheit nicht klar. Aber die Debatte um „problematische Bürokratie“ könnte davon profitieren – mehr als von den rituell vorgetragenen Forderungen nach Rechtsvereinfachung.
„The first ever Commissioner for Implementation and Simplification“
Simplizistische Versprechen, man werde – nach der Europawahl – 1000 Verordnungen abschaffen, sind unseriös oder gefährlich.(10) Denn Vereinfachung tut Not, kostet Geld sowie Zeit und ist eines nicht: einfach. Vereinfachung von Recht und Verfahren ist denn auch seit langem ein Hauptthema der problembezogenen „Entbürokratisierung“. Die EU – rhetorisch immer besonders raffiniert – hat gerade den „first ever Commissioner for Implementation and Simplification“ vorgestellt.(11)
Im Baurecht sind es etwa sogenannte vereinfachte Genehmigungsverfahren, gegebenenfalls auch der völlige Verzicht auf Genehmigungsverfahren, mit denen Vereinfachung und Beschleunigung erreicht werden sollen. Die solches anordnenden Regelungen aber sind immer komplizierter geworden. Denn Vereinfachung und Beschleunigung werden im Recht vorwiegend durch Ausnahmeregelungen operationalisiert. Je mehr Ausnahmen, umso länger und komplizierter die Regelungen und Anhänge. Die Norm der niedersächsischen Bauordnung zum vereinfachten Baugenehmigungsverfahren etwa ist sechsmal so lang, wie die zum klassischen Baugenehmigungsverfahren.(12) Und Länge ist bekanntlich nur ein Aspekt von Komplexität. Solche Kosten der Vereinfachung treffen aber nicht nur die rechtsanwendenden Verwaltungen. Denn die Verfahrensvereinfachung ändert zwar den Umfang des zu prüfenden, aber nicht den Umfang des einzuhaltenden Rechts. In Rechtssprache formuliert: „Genehmigungsfreie und verfahrensfreie Baumaßnahmen müssen die Anforderungen öffentlichen Baurechts ebenso wie genehmigungsbedürftige Baumaßnahmen erfüllen (…)“ (§ 59 Abs. 3 S. 1 NBauO).
Nur, dass es eben keine Baugenehmigung gibt, in der eine Verwaltung den Bauenden und ihren Architektinnen und Architekten die Einhaltung der Anforderungen bestätigt und ihnen also das Rechtseinhaltungsrisiko abgenommen hätte. Auch das Instrument der Genehmigungsfiktion, das zunehmend vorgesehen wird, ändert am einzuhaltenden (Bau-)Recht nichts. In der Pressemitteilung zu „Einfacher, schneller, günstiger“, dem Bürokratieentlastungsprogramm in Niedersachsen wird das wie folgt umschrieben(13): „Der Paradigmenwechsel (Vereinfachungen im Bauprozess, PC) geht einher mit der Stärkung der unternehmerischen Verantwortung und der Förderung von unternehmerischer Freiheit bei der Planung von Bauvorhaben.“
Solange Verwaltungen mit Personalmangel zu kämpfen haben, könnte natürlich das Entdeckungsrisiko der Nichteinhaltung des Baurechts reduziert sein. Etwa in Kauf genommene Rechtsumgehung in einem gewissermaßen augenzwinkernden überforderten Staat wäre aus rechtsstaatlicher und demokratischer Perspektive allerdings ein slippery slope.
Der Sog der Disruption
Bürokratieabbauversprechen und -taten folgen in immer schnellerem Takt. Seit 2015 sind vier Bürokratieentlastungsgesetze erlassen worden.(14) Die Bürokratieforschung erklärt derweil, weshalb der unter anderem von ihr begleitete Bürokratieabbau nicht gelingen kann.(15) Wenn aber Abbauversprechen auf lange Zeit nicht zu weniger „Bürokratie“ führen, weil sie möglicherweise nicht erfüllbar sind, entsteht ein massives Glaubwürdigkeitsproblem. An entsprechende Bürokratiepopulismen der Mitte konnten und können Parteien andocken, deren Entstaatlichungsphantasien ganz andere Dimensionen haben. Die Eskalation der Bürokratieabbauversprechen kann kippen. Fragt sich nur: wohin? Ein Blick in die USA führt uns vor Augen, wie Bürokratieabbau aussehen kann, wenn die Sehnsucht nach Disruption übermächtig wird.

Magnús Tómasson, Óþekkti Embættismaðurinn (Der unbekannte Bürokrat), Reykjavik, Foto: dvoevnore / Shutterstock
Gute Verwaltungen und ihr Recht leiden ein Stück weit am Präventionsparadox. Nur wenige nehmen wahr, wenn sie gut funktionieren, wie richtig oder hilfreich sie sind. Fehlleistungen hingegen sind leicht skandalisierbar. „Administrative literacy“ der Gesellschaft ist also ebenso nötig, wie die andauernde, seriöse Arbeit am Recht, an der Verwaltung, an erforderlicher Vereinfachung. Unkenntnis und bewusst geförderte Ignoranz der Bedeutung von Verwaltungen und Verwaltungsrecht sollte man als Demokratie- und Rechtsstaatsproblem begreifen. Der Pathologisierung von Verwaltung und Recht in aufmerksamkeitsökonomisch überforderten Öffentlichkeiten zu widerstehen, ohne unkritischer Staats-Apologetik zu verfallen, dem mit Einfachheitsversprechen verbundenen Sog nach Disruption nicht nachzugeben, ist nicht nur Aufgabe der Wissenschaft.
Prof. Dr. Pascale Cancik ist seit 2008 Professorin für öffentliches Recht, Geschichte des öffentlichen Rechts und Verwaltungswissenschaft an der Universität Osnabrück. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft in Tübingen und Berlin (FU) wurde sie mit einer Arbeit zur parlamentarischen Opposition in den Landesverfassungen (Tübingen 2000) promoviert. Ihre rechtshistorische Habilitation zur Verwaltung und Öffentlichkeit in Preußen fragte danach, wie die aufklärerische Vorstellung von Öffentlichkeit die Konzeption von Verwaltungen und deren Recht prägten. Neben dem Recht der Demokratie gilt ihr Interesse dem Verwaltungsrecht, insbesondere dem Umweltrecht. Über „Bürokratie“ als Markierung von Staats-, Verwaltungs- und Rechtskritik forscht sie seit 2014 (Fellow am Kulturwissenschaftlichen Kolleg Konstanz). 2017 / 18 war sie mit diesem Thema Fellow am Wissenschaftskolleg zu Berlin.
Fußnoten
1 Weber, Max: Bürokratie, in: ders., Wirtschaft und Gesellschaft. Tübingen 1922, S. 650 – 678 (= MWG Bd. 22 / 4, Tübingen 2005, S. 157 – 234).
2 Hierzu und zum Folgenden: Cancik, Pascale: Zuviel Staat? – Die Institutionalisierung der „Bürokratie“-Kritik im 20. Jahrhundert, in: Der Staat 56 (2017), S. 1 – 38; dies., Bürokratie als negative Markierung. Zur Semantik von Staats- und EU-Kritik, Leviathan 48 (2020), Heft 4, S. 612 – 636.
3 Mohl, Robert von: Ueber Buereaukratie, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 3 (1846), H. 2, S. 330 – 364, der wohl erste wissenschaftliche Erfassungsversuch des neuen Wortes Bürokratie trifft noch heute Wesentliches.
4 Cancik 2017, S. 8 f.
5 Zu nennen wäre der frühe Karl Marx: Marx, Karl: Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Kritik des Hegelschen Staatsrechts (1843), in: Karl Marx; Friedrich Engels, Werke (DDR) Bd. 1, zu „Bürokratie“ besonders: S. 246 ff. In den 1980er-Jahren z.B.: Narr, Wolf-Dieter; neuerdings: Graeber, David: Bürokratie. Die Utopie der Regeln, 2016, wonach der Effizienzdruck auf den Staat, der Kampf gegen die Bürokratie immer neue Bürokratie schafft („ehernes Gesetz des Liberalismus“).
6 Eichhorn, Peter: Mehr Management in Regierung und Verwaltung. Entbürokratisierung von A bis Z, Berlin 2017, S. 86. Das Folgende: S. 87.
7 Vgl. etwa die Erfassung der sogenannten öffentlichen Meinung durch das Allensbach-Institut, das seit 1947 regelmäßig die, verkürzt zusammengefasst, „Bürokratie-Ärger-Frage“ stellt. Siehe: Cancik 2017, S. 23. Seit Ende der 1990er-Jahre bot die Erhebung auf die Frage nach „Assoziationen zu Europa“ und „europäischer Integration“ als eine Antwortmöglichkeit „Bürokratie“ an.
8 Unter: http://wortschatz.uni-leipzig.de/de, Suchwort: Bürokratie (Aufruf: 17.3.2025).
9 Adorno, Theodor W.: Individuum und Organisation, 1954, in: Adorno, Theodor W.: Gesammelte Schriften Bd. 8 (Soziologische Schriften I), (1997), S. 440 – 456, S. 446.
10 Europawahl 2019: Manfred Weber (CSU; Fraktionsvorsitzender der EVP im Europäischen Parlament); ebenso Sebastian Kurz (ÖVP). Wissenschaftlich zur wenig produktiven „Tonnenideologie“: Jann, Werner / Wegrich, Kai / Tiessen, Jan: „Bürokratisierung“ und Bürokratieabbau im internationalen Vergleich – wo steht Deutschland, Studie im Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung 2007, S. 10, S. 35 ff.
11 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION “A Competitiveness Compass for the EU”, 29.1.2025 COM (2025) 30 final, S. 17.
12 § 63 – § 64 NBauO.
13 Erste Ergebnisse siehe: Niedersächsische Landesregierung, Jahresauftaktklausur des Landeskabinetts in Wilhelmshaven am 20. / 21.1.2025, www.stk.niedersachsen.de/startseite/presseinformationen/jahresauftaktklausur-des-landeskabinetts-in-wilhelmshaven-238848.html, insbesondere Anlage 2.
14 Gesetz zur Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Bürokratie (Bürokratieentlastungsgesetz), BGBl. 2015, Nr. 32, S. 1400; BEG II, BGBl. 2017, Nr. 44, S. 2143; BEG III, BGBl. 2019, Nr. 42, S. 1746; BEG IV, BGBl. 2024, Nr. 323, S. 1.
15 Dose, Nicolai: Weshalb Bürokratieabbau auf Dauer erfolglos ist, und was man trotzdem tun kann, in: dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management, Heft 1 / 2008, S. 99 – 120.