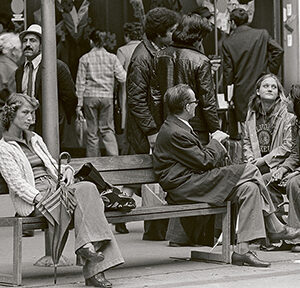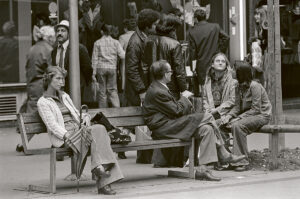Planen für Diversität
Im Interview diskutieren Carmen Mendoza, Stadtplanerin und Professorin an der Universitat Internacional de Catalunya in Barcelona, und Giovanna Marconi, Inhaberin des UNESCO-Lehrstuhls für soziale und räumliche Eingliederung internationaler Migranten an der Università Iuav di Venezia, über die räumliche Dimension von inclusion(1) und darüber, wie Architektur und Stadtplanung auf Migration reagieren und zur Schaffung offener Städte beitragen können. Die Fragen stellte Annette Rudolph-Cleff, Professorin am Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung der TU Darmstadt.
Annette Rudolph-Cleff: Welche Rolle können Stadtplanung und Architektur bei der Bewältigung der Herausforderungen der Migration in immer vielfältigeren Städten spielen?
Giovanna Marconi: Architektur und Stadtplanung können integrative Städte schaffen. Wir sollten uns nicht fragen, was wir für Migrantinnen und Migranten tun können, sondern vielmehr, was wir für die Vielfalt in unseren Städten machen können. Unsere Aufgabe ist es, auf die Bedürfnisse möglichst vieler Menschen einzugehen, die in Städten leben, arbeiten und öffentliche Räume nutzen. Es liegt in unserer Verantwortung, Räume so zu gestalten, dass sie den Bedürfnissen der verschiedenen Stadtbewohnenden gerecht werden. Deshalb sollten wir für eine immer vielfältigere Gesellschaft planen. Dazu gehört, die Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen zu verstehen, deren Präsenz und Ansprüche in der Stadt vor allem aufgrund anhaltender Migration zunehmen.
Carmen Mendoza: Ich möchte betonen, dass die räumliche Dimension der Integration eines der wichtigsten, aber oft übersehenen Themen in der heutigen Migrationsdebatte ist. Und genau hier können Architekten und Stadtplanerinnen einen echten Unterschied machen. Wir müssen uns fragen, wie die gebaute Umwelt und die städtische Form die Fähigkeit von Migrantinnen und Migranten beeinflussen, aktive Mitglieder der Stadt zu werden. Den politischen, wirtschaftlichen und humanitären Aspekten der Migration wird Aufmerksamkeit geschenkt – besonders, da Menschen ihr Leben auf der Überfahrt über das Mittelmeer riskieren, um unsere Städte zu erreichen –, die räumlichen Aspekte werden jedoch oft vernachlässigt. Wir sollten uns fragen: Wie tragen Städte physisch der Vielfalt Rechnung und wie fördern sie Interaktion und Inklusion? Dieser Aspekt sollte ein grundlegender Bestandteil politischer Agenden und Stadtplanungsstrategien sein. Wenn Integration ganzheitlich erfolgen soll, muss sie auf allen Ebenen der Stadt berücksichtigt werden, von der Stadtplanung bis zur architektonischen Gestaltung. Die räumliche Dimension ist von großer Bedeutung – unabhängig davon, ob es sich um vorübergehende oder dauerhafte Unterkünfte handelt. Unsere Disziplin kann durch inklusives Design, verschiedene Typologien und Räume aktiv dazu beitragen, Städte auf physische und greifbare Weise offener und interaktiver zu gestalten.
Welche Bedeutung hat der öffentliche Raum für die Stärkung inklusiver und vernetzter städtischer Gemeinschaften?
Marconi: Der öffentliche Raum ist ein wesentlicher Bestandteil des städtischen Netzwerks. Dieses umfasst Einrichtungen, Dienstleistungen, Freiflächen, kommerzielle Aktivitäten sowie alle Formen des bürgerschaftlichen und gemeinschaftlichen Engagements. Die Art und Weise, wie wir öffentliche Räume gestalten, entscheidet darüber, ob Menschen miteinander interagieren. Andernfalls kann es in multikulturellen Städten dazu kommen, dass verschiedene Gruppen in Parallelwelten leben.
Wie können Vielfalt und zugrundeliegende Konflikte untersucht werden? Wie können Geschlecht, Zugänglichkeit und Sicherheit bei der Gestaltung inklusiver Räume berücksichtigt werden? Wie können wir unterschiedliche Bedürfnisse erkennen?
Marconi: Ich schicke meine Studierenden in multikulturelle Stadtviertel, um vor Ort zu recherchieren. Sie sprechen mit Menschen und Ladenbesitzern, erfassen bestehende Einrichtungen und fragen die Bewohnenden, was sie benötigen, um sich im öffentlichen Raum sicher und wohl zu fühlen. Vielfalt wird oft mit Sicherheitsbedenken in Verbindung gebracht. Diese werden wiederum maßgeblich von politischen Diskursen, Medienberichten und theoretischen Konzepten zu Migration und Vielfalt geprägt. Es ist wichtig zu verstehen, wie verschiedene Gruppen einen Ort erleben und nutzen. Dazu gehören Beobachtung, aktives Zuhören und Forschung. Unsere Städte zeichnen sich durch das aus, was Soziologen als „Superdiversität“ bezeichnen. Dieser Begriff umfasst nicht nur die Nationalität, sondern auch viele andere sich überschneidende Dimensionen von Identität und Verletzlichkeit. Ob jemand eine Frau, ein Kind, ein älterer Mensch oder eine Person mit Behinderung ist, hat Einfluss darauf, wie der Raum wahrgenommen wird und wie man sich darin bewegt. Unser Ziel ist es, diese Perspektiven zu berücksichtigen, gründliche Forschung zu betreiben und damit öffentliche Räume für alle angenehmer und sicherer zu machen.
Mendoza: Ein wichtiger Wandel in unserem Beruf besteht darin, soziale Faktoren in unsere Analysen zu integrieren. Wenn wir der ablehnenden Haltung gegenüber Migrantinnen und Migranten entgegentreten wollen, müssen wir uns von angstbasierten Erzählungen lösen und stattdessen gemeinsame Vorteile vielfältiger Gemeinschaften hervorheben. Der Städtebau bietet hierfür wirkungsvolle Werkzeuge. Integrative Nachbarschaften zu gestalten bedeutet, anzuerkennen, dass Migrantinnen und Migranten die gleichen Rechte haben wie alle anderen, einschließlich des Zugangs zu einladenden öffentlichen Räumen, sicheren Straßen und kulturellen Orten, die Zugehörigkeit fördern und Isolation verringern. Wir sollten daher die Entwicklung von angemessenem Wohnraum in vielfältigen, gemischt genutzten Quartieren priorisieren, in denen sich Menschen niederlassen und aktiv am Gemeinschaftsleben teilnehmen können. Dazu gehört auch die Schaffung von Räumen, die alltägliche Begegnungen fördern, wie Parks, Schulen, Geschäfte. Wenn Menschen einander kennenlernen, hören sie auf, sich als Fremde zu sehen. Das ist die Grundlage für Integration und gegenseitigen Respekt.
Gleichzeitig müssen wir räumliche Gerechtigkeit und Chancengleichheit in der Stadtplanung thematisieren. Das bedeutet, Segregation zu vermeiden und die räumliche Konzentration von Armut zu verhindern. Damit eine sozialgerechte Stadtplanung gelingt, müssen jedoch die Stimmen sowohl der Aufnahmegesellschaft als auch der Migrantinnen und Migranten einbezogen werden.
Wie können Städte ihre Räume und Dienstleistungen so anpassen, dass sie die kulturellen Bedürfnisse und Erfahrungen vielfältiger Gemeinschaften widerspiegeln?
Mendoza: Eine zentrale Herausforderung besteht darin, kulturelle Angemessenheit zu erreichen: Elemente in die gebaute Umwelt zu integrieren, die für Menschen unterschiedlicher kultureller Hintergründe einladend und passend sind.
Marconi: Es ist entscheidend, Barrieren abzubauen, die Menschen mit Migrationshintergrund den Zugang zu Schulen, Gesundheitsversorgung, Bibliotheken und anderen öffentlichen Dienstleistungen erschweren. Dazu gehört sowohl die Entwicklung migrationsspezifischer Angebote als auch die Befähigung von Menschen, bestehende Regelangebote zu verstehen und zu nutzen. Gleichzeitig müssen öffentliche Institutionen ihre Kapazitäten ausbauen. Fachkräfte im Dienstleistungsbereich benötigen die richtigen Werkzeuge und ein Verständnis für vielfältige Bedürfnisse – insbesondere in sensiblen Bereichen wie dem Gesundheitswesen, wo Sprach- und Kulturunterschiede erhebliche Herausforderungen darstellen können. Schulen sind ein gutes Beispiel dafür, wie Integration erfolgreich gelingen kann. Grundschulen in ganz Europa haben Praktiken übernommen, die gegenseitiges Lernen und kulturelles Verständnis fördern. In zunehmend diversen Klassenzimmern gehen die Lehrkräfte oft mit kreativen Ansätzen voran. So lernen Schülerinnen und Schüler etwas über ihre Herkunftsländer, indem sie gemeinsam Gerichte der Eltern probieren oder sich mit familiären Traditionen auseinandersetzen. Diese kleinen, aber bedeutungsvollen Gesten helfen dabei, Brücken zwischen Kulturen zu bauen.
Wie können inklusive Gestaltung und Politik sowohl die Rechte als auch die Würde der verletzlichsten Mitglieder der Gesellschaft wahren und stärken?
Marconi: Wir sollten verstehen, dass wir, wenn wir die Rechte einer Gruppe innerhalb der Gesellschaft aushöhlen, letztlich die Rechte aller aushöhlen. Ich denke dabei etwa an Sitzbänke mit Trennstegen, auf denen man zwar sitzen, aber nicht liegen kann. In Italien haben viele Kommunen sogar begonnen, Bänke ganz zu entfernen, um zu verhindern, dass sich Menschen dort versammeln. Doch wenn Bänke aus dem öffentlichen Raum verschwinden, wird auch allen anderen die Nutzung dieses Raums verwehrt – auch mir, wenn ich müde bin, meiner Großmutter oder Reisenden. Wenn wir die Rechte anderer verweigern, untergraben wir womöglich auch unsere eigenen.
Mendoza: Ich stimme vollkommen zu. Verletzliche Bevölkerungsgruppen, wie zum Beispiel obdachlose Menschen, sind besonders betroffen, wenn Stadtgestaltung nicht inklusiv ist oder es an räumlicher Gerechtigkeit fehlt. Und das betrifft nicht nur die Gestaltung. Es beginnt alles mit politischen Entscheidungen, die Gestaltung folgt dann lediglich und spiegelt die politischen Rahmenbedingungen, die Haltung oder den Blick auf bestimmte Gruppen in der Stadt wider.
Marconi: Man kann es auch andersherum betrachten: Wenn wir den Fokus darauf legen, inklusive Räume für benachteiligte Menschen zu schaffen, werden diese Räume meist für alle inklusiv. Wenn wir die Bedürfnisse derjenigen in den schwierigsten Lebenslagen berücksichtigen, sei es beim Zugang zu Wohnraum, zu Dienstleistungen oder zu öffentlichen Räumen, fördern wir zugleich räumliche und soziale Gerechtigkeit.
Mendoza: Jeder Mensch hat das Recht, in der Stadt mit einem Gefühl der Beständigkeit und Zugehörigkeit zu leben. Es reicht nicht aus, „Migranteneinrichtungen“ oder „vorübergehende Unterkünfte für Migranten“ zu schaffen. Wir haben die Verantwortung, Nachbarschaften zu schaffen: Räume, die kontextabhängig, anpassungsfähig und partizipativ sind. Wenn wir eine erfolgreiche Integration wollen, sollten wir von Anfang an alles richtig machen.
Welche Möglichkeiten gibt es denn für kommunale Akteure, um nachhaltige Strategien zur Integration zu entwickeln, insbesondere im Bereich des Wohnens?
Mendoza: Die Kommunen spielen im Integrationsprozess eine entscheidende Rolle. Idealerweise sollten sie voneinander lernen, indem sie vergleichende oder Längsschnittstudien durchführen, die die Entwicklung der Integration im Laufe der Zeit verfolgen. Besonders wichtig sind Koordinierungsmechanismen zwischen Kommunalverwaltungen, die mit ähnlichen Migrantengruppen zu tun haben. Durch die Zusammenarbeit können sie sich über bewährte Verfahren austauschen, kontextspezifische Herausforderungen identifizieren und gemeinsam integrative Strategien unter Verwendung partizipativer und qualitativer Methoden entwickeln. Die Entwicklung von indikatorbasierten Rahmenwerken würde wertvolle Erkenntnisse darüber liefern, welche Strategien wirksam sind und welche nicht.
Ein gutes Beispiel für diesen Ansatz ist Barcelona. Während der neunjährigen Amtszeit des ehemaligen Bürgermeisters richtete die Stadt ein „Refugee City Office“ ein, das sich auf Integration konzentrierte. Obwohl Barcelona nur eine geringe Zahl von Neuankömmlingen aufnahm, verfolgte die Stadt einen proaktiven Ansatz: sie ermittelte den Bedarf, stellte vorübergehende Unterkünfte bereit, verbesserte Integrationsmodelle und bot Sprach- und Orientierungskurse an. Vor allem aber bemühte man sich bewusst darum, den Migrantinnen und Migranten selbst zuzuhören. Klar definierte Rollen für die kommunalen Akteure sind unerlässlich. In Fällen, in denen die Kommunalverwaltungen versagen, springen häufig NGOs ein. Idealerweise sollte es jedoch eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit zwischen den Kommunalbehörden und den Gemeinschaftsorganisationen geben.
Marconi: Wohnraum ist ein wichtiges Thema, mit dem wir uns seit mehreren Jahren an der Universität Venedig befassen. Die zentrale Herausforderung besteht darin, einen gleichberechtigten Zugang zu Wohnraum für alle zu gewährleisten. Dabei sind vor allem zwei Bereiche zu berücksichtigen: der öffentliche Wohnungsbau und der private Mietwohnungsmarkt. Die Verfügbarkeit von Sozialwohnungen variiert in Europa stark. In Ländern wie Italien sind nur etwa vier Prozent des Wohnungsbestands öffentlich, was bei weitem nicht ausreicht, um den Bedarf zu decken. Dies führt häufig zu einem Wettbewerb unter den Armen. Noch schlimmer ist, dass einige Kommunalverwaltungen problematische Maßnahmen ergreifen. So wird beispielsweise gefordert, dass die Bewerber seit 15 Jahren in der Gegend wohnen müssen. Solche Kriterien schließen Migrantinnen und Migranten effektiv aus. Dies sind institutionelle Formen der Ausgrenzung, die wir entschieden ablehnen.
Das eigentliche Schlachtfeld ist jedoch der private Wohnungsmarkt, auf dem Vorurteile weit verbreitet sind. Beim Unwillen, an „Ausländer“ zu vermieten, gibt es teilweise rassistische Hierarchien: Diejenigen, die als „näher“ an der Mehrheitsbevölkerung wahrgenommen werden, stoßen manchmal auf weniger Hindernisse. Die Reaktion der Zivilgesellschaft spielt daher eine entscheidende Rolle. NGOs, gesellschaftliche und politische Initiativen fördern den gleichberechtigten Zugang und bekämpfen diskriminierende Praktiken. Eine wirksame Strategie besteht darin, nicht nur finanzielle Garantien zu bieten, sondern auch kulturelle und sprachliche Vermittlung. Viele Vermieterinnen und Vermieter sind nicht feindselig eingestellt, sondern haben lediglich Angst vor Kommunikationsbarrieren, Sachschäden oder rechtlichen Komplikationen. Mediation schafft Vertrauen und verwandelt anfängliches Zögern oft in eine langfristige Zusammenarbeit. Zu den vielversprechenden Ansätzen gehört auch die strategische Planung, bei der ungenutzte Gebäude zu kommunalen Zentren umfunktioniert werden. Auf diese Weise bleiben diese Räume über die Notfallphase hinaus wertvolle öffentliche Güter.
Wie können sich Wohninitiativen für Migranten von kurzfristigen Lösungen zu nachhaltigen Lösungen entwickeln und welche Art der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren ist erforderlich, um diesen Wandel zu ermöglichen?
Marconi: Eine große Herausforderung beim Thema Wohnen besteht darin, dass die Kommunalverwaltungen oft zu sehr auf die alltäglichen Anforderungen konzentriert sind, um eine langfristige Integration zu planen. Im Gegensatz dazu arbeiten NGOs im Entwicklungssektor seit langem daran, diese Lücke zu schließen, indem sie oft private Vermieter ermutigen, an Migrantinnen und Migranten zu vermieten. Ein gutes Beispiel hierfür ist ein vom Norwegischen Flüchtlingsrat in Griechenland geleitetes Programm. Die Initiative zielte darauf ab, Anreize für Immobilienbesitzer zu schaffen, an Asylbewerberinnen und -bewerber zu vermieten, indem kostenlose Renovierungsarbeiten angeboten wurden. Im Gegenzug verpflichteten sich die Vermieterinnen, mit der NGO einen Mietvertrag mit einer Mindestlaufzeit von fünf Jahren zu unterzeichnen und ihre Immobilie an einen Asylbewerbenden zu vermieten. Auf diese Weise entstand eine für beide Seiten vorteilhafte Vereinbarung: Die Vermieter, von denen viele von der griechischen Finanzkrise betroffen waren, bekamen renovierte Wohnungen und garantierte Mieteinnahmen, die von der NGO finanziert wurden, während die Asylbewerber Zugang zu sicherem Wohnraum erhielten. Was als Notmaßnahme begann, entwickelte sich allmählich zu einem stabilen, langfristigen Unterbringungsmodell. Das Programm war in Athen nach der syrischen Flüchtlingskrise besonders erfolgreich und führte zur effektiven Nutzung vieler zuvor leerstehender Wohnungen. Programme wie dieses zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl den Einwandernden als auch den lokalen Gemeinschaften zugutekommen und somit eine nachhaltige und integrative Lösung für das Wohnungsproblem darstellen.
Mendoza: Ein weiteres Beispiel ist die Aktivierung leerstehender Wohneinheiten, wie nach der Immobilienkrise 2008 in Spanien. Viele leerstehende Wohnungen befanden sich im Besitz von Banken. Die Kommunen konnten eine Schlüsselrolle spielen, indem sie solche Wohnungen erwerben oder anmieten und sie für gefährdete Gruppen wie Migrantinnen und Menschen, die von Obdachlosigkeit oder prekären Wohnverhältnissen betroffen sind, zur Verfügung stellen. Auch das Konzept der Übergangswohnungen muss neu überdacht werden. Sie dienen als Notlösung, aber es müssen klarere Wege zu dauerhaften Lösungen geschaffen werden. In Städten wie Barcelona werden bei der Ankunft Wohnungen zur Verfügung gestellt, aber ihre Zahl reicht bei weitem nicht. Viele Menschen werden daher von NGOs untergebracht, die mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten. Die Unterkünfte sind in normale Wohngebäude integriert, sodass bereits ein gewisses Maß an Integration gegeben ist. Damit solche Systeme funktionieren, ist jedoch eine Allianz zwischen verschiedenen Akteuren erforderlich: Stadtverwaltungen, NGOs, Anwohner und der Privatsektor.
Welche positiven Beispiele gibt es für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Kommunen und NGOs bei der Verbesserung des Zugangs zu Wohnraum für Migranten und gefährdete Gruppen?
Marconi: Ein positives Beispiel ist ein aus dem Migrations- und Integrationsfonds finanziertes Projekt, das vor etwa 18 bis 20 Monaten abgeschlossen wurde. Die Stadtverwaltung von Padua leitete das Projekt, das sich auf einen verbesserten Zugang zu Wohnraum konzentrierte. In einer Partnerschaft mit NGOs wurden Wohnungen gesucht. Den Vermieterinnen wurden sowohl finanzielle als auch nicht-finanzielle Garantien angeboten. Die Mietzuschüsse wurden nach einem Stufenmodell gewährt: Die Gemeinde übernahm in den ersten sechs Monaten 100 Prozent der Miete, in den nächsten drei Monaten 50 Prozent und in den letzten drei Monaten 25 Prozent. Danach übernahmen die Mieterinnen und Mieter die vollen Zahlungen. Während dieser Übergangsphase boten die NGOs den Migranten kulturelle und sprachliche Unterstützung an, erläuterten die Mietverträge und halfen bei der Integration in die Gemeinschaft, durch lokale Orientierungshilfen und Aufklärung über Mülltrennung. Das Projekt zielte nicht nur darauf ab, die wirtschaftliche Not zu lindern, sondern auch, auf die Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt zu reagieren. Insgesamt wurde nur eine kleine Zahl an Wohnungen vermietet, aber mit bedeutender Wirkung. Leider wurde das Programm nach Auslaufen der Finanzierung nicht im Rahmen der regulären Politik fortgesetzt. Eine parallele Studie der Universität zeigt aber, dass dieser Ansatz kosteneffizienter ist als Notunterkünfte.
Mendoza: Ein gutes Beispiel ist die Stadt Barcelona, in der trotz eines politischen Wechsels die Integrationsbemühungen in der Kommunalverwaltung fortgesetzt wurden. Das 2015 ins Leben gerufene Programm „Plan Corsica“ unterstützt die soziale Integration von Asylbewerbern über den anfänglichen Zeitraum von sechs Monaten hinaus, indem es eine bedarfsgerechte Unterbringung für Einzelpersonen und Familien bietet, in der die Menschen bis zu einem oder zwei Jahren nach Erhalt des Asyls bleiben können. Das Programm deckt die Ausgaben und bietet individuelle Unterstützung, einschließlich sozialer und psychologischer Hilfe, Rechtsberatung, Hilfe bei der Einschulung der Kinder, Sprachkurse und Unterstützung bei der Arbeitssuche. Die Ergebnisse sind positiv und belegen ein hohes Maß an sozialer Integration und Autonomie der Teilnehmenden. Neben den kommunalen Sozialdiensten in den Vierteln waren zahlreiche lokale Einrichtungen und NGOs an dem Programm beteiligt. Die Kombination aus Unterbringung und professioneller Unterstützung zeigt, dass die Flüchtlingshilfe umfassendes kommunales Engagement und ein Netzwerk zusammenarbeitender Organisationen erfordert.
Wie kann Architektur und Stadtplanung zur Förderung von Vielfalt, Gerechtigkeit und Zugehörigkeit in Städten beitragen?
Marconi: Ich denke, dass Planerinnen, Urbanisten und Architekten auf die Schaffung integrativer Städte hinarbeiten sollten. Das bedeutet, dass wir jeder Tendenz zur Ghettoisierung benachteiligter Gruppen entgegenwirken müssen. Wir sollten versuchen, soziale und räumliche Stigmatisierung zu vermeiden. Es ist wichtig, einen Ortsbezug und ein Gefühl der Zugehörigkeit zu ermöglichen, indem wir Räume schaffen, die den Menschen helfen, sich mit ihrer Umgebung verbunden zu fühlen.
Mendoza: Die Schaffung inklusiver Städte ist das Ziel von Städtebau und die Essenz unserer Arbeit. Jane Jacobs hat es meiner Meinung nach sehr treffend ausgedrückt, als sie sagte, dass Städte nur dann funktionieren können, wenn sie für alle konzipiert sind. Städte haben die Fähigkeit, allen etwas zu bieten, aber nur, wenn sie von allen gestaltet werden. Die Planung muss also partizipativ und integrativ sein. Wenn wir das nicht erreichen, dann machen wir unsere Arbeit nicht gut.
Fußnoten
1 In Erweiterung zum deutschen Begriff der Inklusion meint der angelsächsische Begriff „inclusion“ Vielfalt, Teilhabe, Diversität, gesellschaftliche Offenheit und Zugehörigkeit.