Zeit für Utopien
„Unsere größte Sorge ist, dass einmal die Baukonjunktur abreißt.“ Gesagt hat das Heinrich Plett, vor genau 60 Jahren. Plett hatte für die ihm unterstellte Wohnungsbaugesellschaft ein Geschäftsmodell entwickelt, das neben Fremdfinanzierung vor allem auf dauerhaftes Wachstum und damit einhergehende stetig hohe Wohnungsnachfrage angewiesen war. „Mit Eigenkapital zu bauen, ist keine Kunst. Das kann jeder Dummkopf. Wir bauen unsere Häuser mit anderer Leute Geld, und wenn wir es vom Teufel holen.“ Wohin diese Haltung führte, haben manche bis heute vor Augen: Am 19. September 1986 verkauften die Deutschen Gewerkschaften den damals größten Städtebaukonzern der westlichen Welt für den symbolischen Preis von 1 DM. Die Rede ist von der Wohnbaugesellschaft „Neue Heimat“. Die Konjunktur war abgerissen, die Wohnungsnachfrage ab den 1970er Jahren in etwa gedeckt, der Konzern ein Jahrzehnt später tief verschuldet. Käufer war ein weitgehend unbekannter Berliner Bäckereiunternehmer. Der Skandal rund um unlautere Praktiken und persönliche Bereicherungen der Vorstände des Unternehmens erschütterte das ganze Land.

Wohnanlage Hamburg-Ochsenzoll, Bürgermeister Max Brauer spricht am 17.11.1960 auf dem Richtfest für 3805 Wohnungen der Neuen Heimat, Foto: HAA NH Film NL750
Bereits 1966 war die Neue Heimat Europas größter Wohnungsbaukonzern. Allein 1973 wurden 714.000 neue Wohnungen in der Bundesrepublik Deutschland gebaut. Zum Vergleich: 2017 waren es zwischen 250.000 und 300.000. Einige Jahre war es schließlich ruhig geworden um das wilde Fahrwasser, in dem dieser Riese bundesdeutscher Stadtentwicklung und Wohnungswirtschaft unterging. Erst 2008 setzte eine grundlegende wissenschaftliche Aufarbeitung mit dem Erscheinen der Dissertation des Historikers Peter Kramper ein. Nun, gut zwanzig Jahre nach dem Bankrott, setzen gleich zwei Publikationen dazu an, die Entwicklung der Neuen Heimat nachzuzeichnen. Michael Mönninger bei Dom-Publishers und Ullrich Schwarz als Herausgeber eines wahren Mammutwerks im Hamburger Verlag Dölling und Galitz.
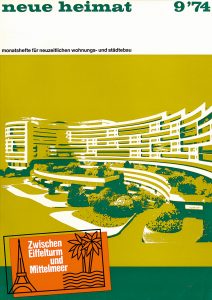
Titelblatt der Neue Heimat Monatshefte. Die Hefte waren ein allgemein anerkanntes Fachorgan für aktuelle Fragen des Wohnungs- und Städtebaus, Abb.: HAA
Schwarz und seine Mitstreiter haben für „neue heimat. Das Gesicht der Bundesrepublik“ 25.000 Fotos, über zwanzig Stunden Film und hunderte Pläne gesichtet. Das Ergebnis ist ein über 800-seitiges Nachschlagewerk, an dem sich bundesdeutsche Entwicklung gut nachzeichnen lässt: architektonisch, städtebaulich, gesellschaftlich, wirtschaftlich. Acht Kapitel und ein reichhaltiger Anhang mit Chronik sowie Registern der handelnden Personen, Architekten, Orten und Autoren, gliedern das Buch. Dabei wird die Geschichte der Neuen Heimat (NH) von der Entstehung über ihre Blüte bis hin zur Abwicklung ebenso umfangreich dargestellt wie ihre Rezeption in den Printmedien sowie in Funk und Fernsehen. Anhand von konkreten Projekten wie dem Columbus-Center in Bremerhaven, dem Internationalen Congress Centrum in Berlin, der Bank für Gemeinwirtschaft in Frankfurt am Main, dem Klinikum Aachen oder Grundschulen in München-Neuperlach erzählt die Publikation auch, wie die Neue Heimat mit ihrer Tochter „Neue Heimat Städtebau“ vom gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen zum profitorientierten Developer mutierte.
Bisweilen nachgerade skurril lesen sich Episoden aus der Zeit des NH-Tochterunternehmens „Neue Heimat International“, das Projekte in europäischen Nachbarländern wie Frankreich und Österreich entwickelte, aber auch für Lateinamerika oder Sri Lanka plante. „Im Fundus der Neuen Heimat gibt es einige obskure Projekte, deren Geschichte völlig im Dunkeln bleibt“, schreibt etwa Karl H. Hoffmann, wenn er die Pläne für ein Hotel und einen Flughafen in Asunción aus dem Jahr 1968 zu beleuchten versucht. „Wieso entwirft ein deutsches Gewerkschaftsunternehmen 1968, im Jahr der Studentenunruhen, Bauten für die Regierung in Paraguay?“, fragt der Autor zurecht, zumal dort mit General Alfredo Stroessner ein Machthaber regierte, der seine Diktatur damals im 14. Jahr aufrechterhielt: ein Mann, dem „kein DGB-Funktionär öffentlich die Hand geschüttelt hätte“, wie Hoffmann konstatiert.
Liest man im Buch, werden die Parallelen zwischen den 1960er- und 1970er-Jahren und unserer Zeit so deutlich, dass man jeder heute handelnden Person auf Bundes-, Stadt- und Kommunalebene wenigstens eine Zusammenfassung, wenn nicht gleich die ganze Publikation als Pflichtlektüre an die Hand geben möchte. Die Forderung, schnell, viel Wohnraum zur Verfügung zu stellen und das möglichst kostengünstig, steht auch heute vielfach im Raum. Einem Heilsversprechen gleich wird dabei immer wieder das serielle Bauen und die Erweiterung unserer bestehenden Städte benannt. All das findet man in der Geschichte der Neuen Heimat. Aber: In den 1970er Jahren gehörten die Wohnungen der Neuen Heimat zu den teuersten Mietwohnungen im gesamten Wohnungsbestand der Bundesrepublik.
Die Projekte, mit denen die Neue Heimat erst groß wurde und die sie dann in Verruf brachten, sind allesamt im Buch zu finden. Von Kleinoden wie der Documenta Urbana in Kassel über Projekte im Bestand in Berlin Kreuzberg zu den bekannten Beispielen des Großsiedlungsbaus vom Mettenhof in Kiel über die Bremer Neue Vahr und Darmstadt Kranichstein bis München Bogenhausen. Dazu kommen Exkurse, die die handelnden Personen vorstellen: Ernst May etwa, den „planwütigen Außenseiter“, der eng mit dem Aufstieg der Neuen Heimat verknüpft war. Hans Bernhard Reichow, der durch seine vielfältigen Betätigungen von Planung über Lehre bis hin zum Schreiben von Filmdrehbüchern zu einem der wohl wichtigsten Protagonisten „organischer“ Stadtbautheorien wurde. Oder Hans Vietor, der sich als „Mann aus kleinen Verhältnissen“ hochgearbeitet hatte und das Ende der Neuen Heimat maßgeblich mitbestimmte und -verantwortete.
Schließlich, als sich die Neue Heimat längst zum Immobilien-Entwickler großen Stils verändert hatte, hatten Hans Vietor und seine Kollegen „… einen Zustand herbeigeführt, den man treffend so beschreiben kann: Der Schuldendienst für Kredite bei rund 150 Banken überstieg dauerhaft die Einnahmen.“ Uwe Bahnsen fasst dies zum Ende des Buchs lapidar zusammen, nicht ohne aber darauf hinzuweisen, dass es sich dabei um eine auf vielen Ebenen wirkende „vollständige Katastrophe“ handelte.

Naherholungszone mit Wasserbecken in Neu-Altona, dem größten Wiederaufbaugebiet Hamburgs, errichtet nach Plänen von Ernst May, 1962, Foto: HAA NH Film NL970
Das Feld für den Übertrag ins Jahr 2019 aber macht Ullrich Schwarz bereits in seiner Einleitung auf. „Die Realität ist: In einem äußerst angespannten Markt steigen die Baupreise und auch die Grundstückspreise. Da kann auch das ‚serielle Bauen’ wenig Abhilfe versprechen. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Ohne politische Interventionen wird ‚der Markt’ keine ‚bezahlbaren‘ Wohnungen hervorbringen.“ Damit unterstreicht Schwarz die aktuelle Relevanz der Beschäftigung mit der Neuen Heimat und fragt sinnfällig, ob nicht auch heute wieder – wenngleich anders als vor sechzig Jahren – über sozialen Wohnungsbau und gemeinnützige Wohnungsunternehmen nachgedacht werden müsste. Ja, das muss wohl getan werden. Ebenso wie die Frage des Herausgebers, ob die Politik sich an das Bodenrecht herantrauen sollte, mit einem deutlichen ‚Ja’ beantwortet werden muss. Die Zeit, für aktuelle, zeitgemäße „sozialdemokratische Utopien“ ist wieder da. Auch das schreibt Schwarz in diesem in jeder Hinsicht beeindruckenden Buch.
David Kasparek
Ullrich Schwarz (Hrsg.): neue heimat. Das Gesicht der Bundesrepublik. Bauten und Projekte 1947–1985, mit Beiträgen von Norbert Baues, Robert Galitz, Karl Heinz Hoffmann, Gert Kähler, Peter Kramper, Lars Quadejacob, Dirk Schubert und Ullrich Schwarz, 808 S., 960 historische und Farbabbildungen, fadengeheftetes Hardcover, 79,90 Euro, Dölling und Galitz Verlag, Hamburg 2019, ISBN 978-3-86218-112-4
Der Titel begleitet eine Ausstellung des Architekturmuseums der TUM und des Hamburgischen Architekturarchivs in Kooperation mit dem Museum für Hamburgische Geschichte. Die Ausstellung „Neue Heimat“ ist in München ab dem 28. Januar und in Hamburg ab dem 27. Juni zu sehen.
- Ullrich Schwarz (Hrsg.): neue heimat. Das Gesicht der Bundesrepublik. Bauten und Projekte 1947–1985, mit Beiträgen von Norbert Baues, Robert Galitz, Karl Heinz Hoffmann, Gert Kähler, Peter Kramper, Lars Quadejacob, Dirk Schubert und Ullrich Schwarz, 808 S., 960 historische und Farbabbildungen, fadengeheftetes Hardcover, 79,90 Euro, Dölling und Galitz Verlag, Hamburg 2019, ISBN 978-3-86218-112-4
- Titelblatt der Neue Heimat Monatshefte. Die Hefte waren ein allgemein anerkanntes Fachorgan für aktuelle Fragen des Wohnungs- und Städtebaus, Abb.: HAA
- Wohnanlage Hamburg-Ochsenzoll, Bürgermeister Max Brauer spricht am 17.11.1960 auf dem Richtfest für 3805 Wohnungen der Neuen Heimat, Foto: HAA NH Film NL750
- Naherholungszone mit Wasserbecken in Neu-Altona, dem größten Wiederaufbaugebiet Hamburgs, errichtet nach Plänen von Ernst May, 1962, Foto: HAA NH Film NL970
- Hamburg Farmsen, Ladenzeile aus nördlicher Blickrichtung, Foto: HAA NH FH 1.02.028
- Mustereinrichtung für ein Wohnzimmer im Hochhaus von Alvar Aalto in der Neuen Vahr Bremen, Foto: HAA NH FBA 93
- München Hasenbergl, Wohnhochhäuser, Foto: HAA NH FH 1.11.08.046
- Alsterzentrum Hamburg, Fotomontage, Blickrichtung Nordost, im Vordergrund die Lombardsbrücke, Abb.: HAA NH FAB 001
- Kiel Mettenhof, Wiese vor dem Einkaufszentrum und weißem Riesen, Foto: HAA NH FH 1.03.06.11
- Hamburg Mümmelmannsberg, Luftbild der Siedlung, 1973, Foto: HAA NH FA 159
- Hamburg Mümmelmannsberg, gepflasterte Freiflächen vor terrassierten Geschosswohnblöcken, Foto: HAA NH FH 1.02.014.1
- Demonstration der Beschäftigten in Düsseldorf gegen die Führung der Neuen Heimat und den DGB, vermutlich 1982, Foto: HAA NH FH 8.08
- Der gewerkschaftseigene „Promarkt“, 1966, Nachfolger der „Produktion“ im Elbe-Einkaufszentrum, Foto: HAA NH FH 3 3 202 1 (1k)
- Klinikum Aachen, eines der Hauptgebäude, Abb: HAA NH DJ 6 1 2 5
- Congress Centrum Hamburg und Loews Plaza Hotel, 1973, Foto: HAA NH FH 6 4 2
- Ciudad Satélite, Naucalpan de Juárez, 1974–1978, Zona Colonial, Foto: HAA NH FH 8.01
- Grindelhochhäuser in Hamburg-Harvestehude, 1946 – 1956, Foto: HAA, F405 Baubehörde Lichtbildnerei 11752

























