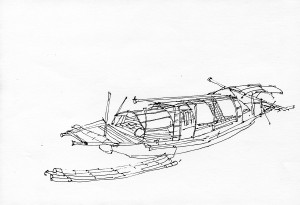Experimente wagen
Prof. em. Dr.-Ing. E.h. Thomas Sieverts, 1934 in Hamburg geboren, studierte Architektur und Städtebau in Stuttgart, Liverpool und Berlin. Nach seinem Diplom 1962 war er für zwei Jahre als Mitarbeiter an der Technischen Universität Berlin tätig, ehe er die Freie Planungsgruppe Berlin (FPB) ins Leben rief. Ab 1967 lehrte Sieverts Architektur und Städtebau an der Hochschule für Bildende Künste Berlin, der Harvard University und der TH Darmstadt. 1978 gründete er ein eigenes Planungsbüro, das im Jahr 2000 erweitert und in S.K.A.T. Architekten + Stadtplaner umbenannt wurde. 1995 arbeitete Sieverts als Forschungsgelehrter am Wissenschaftskolleg Berlin, wo er den Begriff „Zwischenstadt“ prägte. 2003 wurde er vom BDA für sein Engagement im Gesamtprojekt des Bochumer Westparks ausgezeichnet, er ist zudem Träger des Deutschen Städtebaupreises und des Fritz-Schumacher-Preises des Hamburger Senats und Mitglied der Sektion Baukunst der Akademie der Künste Berlin. Thomas Sieverts, dem die Technische Universität Braunschweig 2010 die Ehrendoktorwürde verlieh, lebt und arbeitet in Bonn und München.
Welche Städte haben in Ihrem Leben eine besondere Bedeutung?
Zuerst einmal ist das sicher meine Heimatstadt Hamburg. Ich interessiere mich für das, was ich jetzt mache, seit dem letzten Grundschuljahr. Für dieses Interesse war Hamburg meine Anschauungswelt des Bauens. Die Lehrerin hatte uns das Aufsatzthema gestellt „Mein liebstes Spielzeug“ und ich habe den Baukasten beschrieben, mit dem ich spielte – und mein Interesse am Planen und Bauen ist kontinuierlich weiter gewachsen.
Die Nachkriegsjahre waren eine Ausnahmezeit, besonders für meine Generation: Wir kamen als erster Jahrgang nach dem Krieg wieder auf das Gymnasium und gehörten damit quasi zu den privilegierten Kriegsgewinnlern: die Nazis waren weg, die Welt ging wieder auf, und die Engländer haben als Besatzungsmacht eine sehr fortschrittliche Kulturpolitik mit ihren Kulturzentren betrieben. Ich bin ein Produkt der „reeducation to democracy“. Unsere ersten Begegnungen mit der westlichen, hauptsächlich englischen und amerikanischen Welt trafen uns Elf- oder Zwölfjährige sehr aufnahmefähig. Später waren wir natürlich auch beruflich privilegiert, denn die Welt musste ja wieder aufgebaut werden. Bei meiner Berufswahl hat das zwar nicht bewusst mitgespielt, aber die Fragen des Wiederaufbaus waren auch die des Städtebaus und viel mehr als heute Gesprächsthema. Wir waren also in mehrfacher Hinsicht privilegiert: einmal über die bürgerliche Herkunft und das Gymnasium, und dann über die Aufgaben in der Stadt und den Beruf als Architekt. Die Generation vor uns war durch den Krieg so dezimiert, dass wir in jungen Jahren in Positionen einrückten, die uns früher sicher so nicht offen gestanden hätten. Unsere persönlichen Erfolge sind nicht nur persönliches Verdienst, sondern wir sind in eine spezifische historische Situation hineingeboren worden. Diese Zeit habe ich in Hamburg erlebt. In der Baubehörde arbeitete auch schon Christian Farenholtz, mit dem ich mich unterhalten konnte. Hamburg war sehr prägend und hat mich bis heute begleitet, nicht zuletzt mit Egbert Kossak als Freund, Partner und Mitbegründer der „Freien Planungsgruppe in Berlin“(FPB), dessen Tätigkeiten ich immer verfolgt habe.
Was unterscheidet Hamburg von anderen Städten?
Ganz sicher eine gewisse Großzügigkeit, die ich dann später in Stuttgart in meinem ersten Studienjahr sehr vermisst habe: die Großzügigkeit des Maßstabs, des Hafens, der Elbe. Es war eine Stadt, die mich in Maßstabsfragen sehr geprägt hat. Stuttgart habe ich gehasst, aber das liegt auch daran, dass ich unglücklich verliebt war und die Stadt dadurch bis heute für mich dunkel eingefärbt ist.
Wir mussten damals – eine sehr vernünftige Regelung – ein Jahr nach dem Vordiplom in einem Architekturbüro arbeiten. Ich habe bei dem damals noch jungen Architektenpaar Ingeborg und Friedrich Spengelin Werkzeichnungen gemacht, aber auch am Wettbewerb Hauptstadt Berlin 1957/58 mit gezeichnet. Bei unserem Betriebsausflug nach Berlin, als Belohnung für den gewonnenen Wettbewerb, beschloss ich, in Berlin weiter zu studieren. Von 1958 bis 1970 bin ich zwölf Jahre lang in Berlin hängen geblieben. Nach dem eher verschulten Vordiplom in Stuttgart hatte ich an der TU Berlin große Freiheiten, mein Studium selbst zu gestalten. Berlin war wahrscheinlich die Stadt, die mich am stärksten geprägt hat. Von Berlin aus ging ich für ein Jahr zum Studium nach Liverpool. Diese Stadt im Besonderen und England im Allgemeinen haben mich ebenfalls beeinflusst. England war damals für Stadtplaner das gelobte Land.
Aufgrund der New Town Policy?
Ja, es war für mich die New Town Policy, die England damals so faszinierend machte, aber auch die „Open University“ und der „National Health Service“ waren Merkmale einer idealen Gesellschaftsform. Ich hatte damals eine indische Freundin in London, und so habe ich diese Stadt aus der Sicht der Inder kennengelernt. London hat mich ebenfalls stark geprägt. Als Hochschullehrer hatte ich dann später viel Austausch mit englischen Universitäten. Hamburg, Berlin, London und Liverpool haben mich in all ihrer Unterschiedlichkeit bis heute als Referenzräume begleitet.
Sie sind früh über die Grenzen Europas hinausgegangen und haben sich unterschiedliche Welten angeschaut?
Bevor ich Diplom machte, ging ich für drei Monate nach Ghana im Rahmen eines der ersten Austauschprogramme, die nicht vom Staat, sondern von der Wirtschaft organisiert waren. Wir wurden als Praktikanten auf unterschiedliche Arbeitsstätten verteilt. Ich habe zum Beispiel bei einem Vermessungsingenieur gearbeitet und sechs Wochen lang im Busch die Trasse für eine neue Straße und für eine Brücke vermessen. Ich bin direkt nach dem Aufenthalt in Ghana ins Diplom gegangen und habe mir dafür eine Diplomaufgabe aus Ghana mitgebracht. Damals begann gerade die Aufstauung des Volta Lakes, für die drei Dörfer verlagert werden mussten, das habe ich mir als Thema gewählt.
Ein spannender Weg, in dem Sie den Maßstab der Region für sich erobert haben.
Den habe ich von Anfang an betrachtet. Das ist auch ein Einfluss von Hamburg: Fritz Schumacher war einer der ersten, der sehr weitsichtig die Hamburgische Landesplanung erdacht hat. Das hat mich immer fasziniert. Dieses Ausweiten der Planungsdefinition fand ich spannend.
Auch wenn es schwer ist, in diesem Maßstab zu entwerfen?
Regionalplanung steckte ja noch in ihren Anfängen und Architektur und Städtebau waren ziemlich erstarrt. Der Funktionalismus war schon am Austrocknen und Ästhetik war auf Ablesbarkeit von Funktion, Konstruktion und Proportion reduziert. Erst in den sechziger Jahren kamen die ersten Aufbrüche. Für mich beispielsweise war das Buch von Kevin Lynch „The Image of the City“ ausschlaggebend, erschienen 1960 in Amerika und 1964 als „Bauwelt Fundamente“. Es war für mich ein Erweckungserlebnis.
Historisch gesehen begann nach meinem Studium Anfang der sechziger Jahre eine Aufbruchszeit. Bis dahin waren Architektur und Städtebau mit geringem theoretischen Anspruch. Mit Kevin Lynch kam ein völlig neuer Blick auf die Stadt, der mich faszinierte. In diese Zeit gehört auch die Gründung der Freien Planungsgruppe Berlin (FPB) mit Egbert Kossak und Herbert Zimmermann, in der wir eines der ersten reinen Stadtplanungsbüros in der Bundesrepublik als Genossenschaft auf der Basis ziemlich sozialistischer Prinzipien organisierten und in dem wir methodisch neue Wege einschlugen: Das Bundesbaugesetz war gerade erlassen worden und viele kleinere Gemeinden hatten noch keine Planungsämter. Mit der FPB ersetzten wir für einige Jahre für viele Gemeinden diese Ämter.
1967 wurde ich Professor für Städtebau an der Hochschule der Künste Berlin und geriet alsbald mitten in die Studentenunruhen von 1968. An einen normalen Unterricht war in dieser Situation nicht zu denken. Ich habe mit den Studierenden dann Lehrveranstaltungen gemacht auf der Grundlage von Kevin Lynchs Studien. Wenig später kam noch ein anderer theoretischer Zugang dazu: In Stuttgart hatte ich als faszinierenden Professor Max Bense mit seiner Semiotik erlebt. Diese Semiotik versuchten wir auf die Stadt anzuwenden und Stadt als Zeichenfeld zu deuten. Mit solchen Anregungen ging ein neuer Horizont auf. Das war eine wunderbare Zeit, denn damals konnten wir mit Studenten noch originäre Forschung betreiben.
Es ist heute für die Studierenden schwieriger geworden, sich auf das genuin Politische im Städtebau einzulassen.
Natürlich war unser Vorgehen, als ich mit meinen Studenten die Umweltvorstellungen von Schülern im Wedding aufgezeichnet oder in der Analyse eine Ecke des Kurfürstendamms nach semiotischen Gesichtspunkten schichtenweise entblättert habe, aus heutiger Sicht naiv. Aber es war das Privileg, naiv sein zu können, weil es noch kaum Forschungen auf diesem Gebiet gab. Man konnte frisch ins Ungewisse hineindenken. Das ging leider nur wenige Jahre, bevor die Fachdisziplinen zugriffen und es kompliziert wurde, nicht zuletzt weil man die Naivität eingebüßt hatte.
In Ihrem Buch „50 Jahre Städtebau“ beschreiben Sie Ihre eigene Begeisterung für die Moderne, mit der Sie in Ihre berufliche Laufbahn gestartet sind.
Ich war als Schüler und junger Student ein dogmatischer und fanatischer Bauhäusler und Funktionalist. Ich habe als 17-Jähriger auf dem Gymnasium über moderne Architektur eine Facharbeit geschrieben, in der ich nachweisen wollte, dass sich diese ausschließlich funktional erklären lässt. Da gab es noch nicht viele Anschauungsbeispiele in Hamburg, lediglich die Grindelhochhäuser, die Wohnhausgruppe von Bernhard Hermkes und von J. P. Oud die Reihenhäuser in Stuttgart, in denen ich später auch wohnte. Ich bin mit meinem Versuch als Schüler natürlich gescheitert, so dass ich Hilfskonstruktionen von Funktionen psychologischer Art einführen musste, um an meinem Glaubensbekenntnis festhalten zu können (lacht).
Ich möchte an dieser Stelle nach dem Doppelcharakter der Moderne fragen, nach der Geschichtlichkeit und der konzeptionellen Aktualität, die die Moderne immer noch hat.
Nach wie vor betrachte ich mich als Vertreter der Moderne. Auch will ich meine Herkunft nicht verleugnen, die fast religiöse Inbrunst im Glauben an die Moderne, diesen Glauben habe ich heute jedoch nicht mehr. Aber die großen Klassiker wie die Taut-Siedlungen und die frühen Ernst May-Siedlungen sind immer noch hervorragend und unübertroffen. Es war natürlich Siedlungsbau. Was wir später im Städtebau gelernt haben und was ich selbst noch in den ersten Jahren meiner Hochschultätigkeit gelehrt habe, war ja auch Siedlungswesen. Heute muss aus der klassischen Moderne etwas anderes entwickelt werden; Funktionalismus, Konstruktion und Materialgerechtigkeit haben im Zeitalter des Anthropozän ihr Wesen gründlich verändert.
Es gibt allerdings auch gute Projekte aus späterer Zeit, die leider in der Kritik der Nachkriegsmoderne untergehen.
Ja, da besteht eine Pflicht der zeitgenössischen Architekten und Publizisten, insbesondere Projekte aus den fünfziger Jahren wie beispielsweise die frühen Arbeiten von Friedrich und Ingeborg Spengelin oder Lillington Street in London hervorzuziehen und diese Tradition des städtischen Wohnungsbaus, die fabelhafte neue Erfindungen hervorgebracht hat, neu aufzuarbeiten.
Inwiefern sehen Sie die Ideen und Politikgeschichte der europäischen Stadt als Chance für die zukünftige Stadtentwicklung?
Die Verengung des Begriffs der europäischen Stadt auf die Form fand ich immer als unzulässig, aber die europäische Stadt als Sinnbild für Solidarität und Zusammengehörigkeit ist nach wie vor aktuell und präsent. Die Verengung der Stadtdiskussion auf das simple Schema Gasse, Hof, Platz, auf den bergenden Raum, ist mir zu wenig.
Die Stadt kann sich in ihrer Lebendigkeit auch anders zeigen. Hier ist zum Beispiel mein Sohn Boris für mich ein wichtiger Gesprächspartner, da er die Qualitäten der selbstgemachten Welten der kleinen Leute hervorhebt. Ich habe 1968 mit meinen Studenten in Berlin unter Bezug auf Bense, Lynch und die ersten Stadtsoziologen der neuen Generation halb kaputte Ruinengebiete, Kleingärten und Dauercampingplätze untersucht. Diese Campingstädte waren als Folge der Mauer entstanden. Die selbstgebauten Hütten und Zeltstädte haben wir unter dem Stichwort „Volksarchitektur“ untersucht, unter der These, dass dies eine „Architektur“ ist, die nicht durch Planung, Kontrollen und Genehmigungen gegangen ist, die „ursprünglich“ ist. Da sind wir auf völlig neue Ästhetiken gestoßen: des Selbstausdrucks, der Repräsentation. Wir haben festgestellt, dass bei diesen selbst errichteten Bauten die Repräsentation mindestens so wichtig ist wie die Funktion, selbst wenn es sich um ganz einfache Hütten handelt. Repräsentation ist immer vorhanden über Elemente wie Symmetrie, Gipsskulpturen im Garten oder über die Farbe. Diese Gleichgewichtigkeit von Ästhetik, Repräsentation und Funktion haben wir in den selbstgebauten Dingen erkannt. Von dieser Erkenntnis war es dann auch nur ein kurzer Schritt in die Entwicklungsländer, wo wir Parallelen zwischen den Shanty Towns und den Kleingartengebieten in Berlin fanden. Diese Gedanken hat mein Sohn Boris sehr viel intensiver weiterentwickelt mit seinen Führungen.
Diese Überlegungen zählen für mich nach wie vor zu den Wichtigsten: Wie erhalten die Bewohner in der Stadt die Möglichkeit, sich selbst auszudrücken? Inwieweit sind sie in ihrem Ausdruck fremdbestimmt? Ich habe immer noch keine Antwort darauf gefunden, wie das in unserer verwalteten Welt geschehen kann. Die Erweiterung der Ästhetik der Stadt hat mich schon immer beschäftigt, um nicht stehen zu bleiben bei den konventionellen Maßstäben und Antworten darauf, was Schönheit ist. Es gibt Schönheiten völlig anderer Art in der Stadt.
Und all dies war Mitte der siebziger Jahre zu Ende?
Ja. Dieses Ende habe ich erlebt und es war ein Schock, dass plötzlich alles Soziale und Progressive nicht mehr galt und nur noch restaurative Kräfte wirkten. Das war vorbereitet von der konservativ-bürgerlichen Publizistik und heute gibt es kaum noch irgendeine andere Strömung. Auch die Politik hat sich – unabhängig von Parteigrenzen – auf diese restaurative Richtung eingelassen, ist das nicht so?
Man bietet lieber zum tausendsten Mal das Gleiche an, als das Risiko einzugehen, Fehler zu machen. Es liegt eine große Starrheit in den Dingen…
…und Muffigkeit. Heute interessiert das Thema Städtebau, wie wir es hier verhandeln, niemanden mehr. Es ist kein Thema, das politische Priorität hat, kein Anliegen der öffentlichen Debatten, außer es geht um geschmäcklerische, restaurative Tendenzen oder spektakuläre Bauten wie die Elbphilharmonie. Natürlich sind das tolle Projekte, aber es sind eben Unikate, mit denen man keinen Städtebau machen kann. Wenn man heute Politiker werden will, kann man mit diesem Thema keine Karriere machen. Das war anders in den fünfziger bis siebziger Jahren, da gab es beispielsweise noch einige alte Gewerkschaftsrecken aus der alten sozialdemokratischen Zeit der zwanziger Jahre, dazu gehörten auch Teile der Neuen Heimat. Die Neue Heimat kann man nicht nur verdammen, sie war in ihren ersten Jahrzehnten nach dem Krieg die innovativste Wohnungsbaugesellschaft in Deutschland und sie hat auch viel experimentiert.
Mit dem Gleichgrundsatz der Förderung und der Reduktion auf den Wohnungsbau hatte sie keine Chance, die frühen sozialreformerischen Konzepte weiterzutragen. Man wollte aus Angst vor dem Kommunismus die Wohnungsgemeinnützigkeit nicht mehr wiederbeleben und dem Erstarken der Wohnungsbaugesellschaften vorbauen.
Natürlich war das Genossenschaftswesen auch selbst ausgetrocknet. Die Genossenschaften waren meist nur noch Wohnungsverwalter, die den kooperativen Gedanken nicht mehr gepflegt haben.
Es ist bedauerlich, dass die Kommunen selbst überfordert sind.
Das empfinde ich auch als große Enttäuschung, denn die deutschen Kommunen haben politisch einen hohen Grad an freier Gestaltungsmöglichkeit, aber sie nutzen dies nicht, sondern sind meist reine Verwaltungseinheiten, die hauptsächlich Bundesrecht exekutieren. Dass sich Kommunen selbst als Gestaltungseinheiten sehen, gibt es nur noch im Einzelfall. Man hört immer wieder einmal von Bürgermeistern, die neue Wege gehen, aber das sind Wenige. Unsere Gesellschaft braucht dringend wirkliche Experimentierräume, in denen in einem begrenzten Raum und für eine begrenzte Zeit bestimmte Reglements außer Kraft gesetzt werden können, um wirklich Neues auszuprobieren. Diese Frage treibt mich zur Zeit am meisten um: Wie bleibt unsere Gesellschaft offen und entwicklungsfähig? Wohin gehen unsere nächsten Schritte? In den fünfziger und sechziger Jahren, und auch als wir die Freie Planungsgruppe gegründet hatten, gab es noch den naiven Optimismus, mit Planung neue Schritte gehen zu können – davon ist kaum noch etwas vorhanden.
Es gab noch einmal einen kurzen Aufbruch, das war die Internationale Bauausstellung Emscher Park (1989–1999), an der ich einige Jahre verantwortlich mitgewirkt habe. Dies war ein großes Experiment „von oben“ mit vielen interessanten Ergebnissen. Heute hat sich der Begriff der IBA fast inflationär verbreitet und wurde dabei verwässert, aber auch hier gibt es hoffnungsvolle neue Ansätze.
Es ist auch schwieriger geworden, Finanzierungswege zu finden.
Das ist es, wobei ich glaube, dass sich, wenn die Idee stark genug ist und sich genügend Leute dahinter versammeln, noch immer Finanzierungsquellen finden würden. Wir haben so viele reiche Bürger und so viele reiche Stiftungen…
… die gehen aber keine Risiken ein.
Nein, es liegt auch eher an der Konzeptschwäche. Wenn es starke Konzepte gibt und starke Pioniere, die das wirklich wollen, und wenn es die Unterstützung der öffentlichen Meinung gäbe, so meine ich, dass es in unserer superreichen Gesellschaft nicht an Risikokapital mangelt. Es ist letztlich kein Geldproblem, sondern eher eines der gesellschaftlichen Lebendigkeit, der Kraft zur Selbstorganisation und des geistigen Mutes von Pionieren, etwas auszuprobieren.
Woher soll der Antrieb kommen? Harald Welzer und Richard David Precht beispielsweise sind sich sicher, dass die Universitäten mit der Exzellenzforschung soweit ausgepowert sind, dass von ihnen keine politischen Impulse mehr zu erwarten sind.
Aber die Architektur gehört ja nirgendwo zu den Exzellenzfächern. Ich denke, viele erwarten, dass gerade aus Richtung der Architekturfakultäten wieder Initiativen zu Experimenten kommen.
Unsere Planungsverfahren sind zu komplex geworden und binden über lange Zeiten viele Kapazitäten.
Auch innovative Planungen sind bürokratisch so reglementiert, dass kaum noch neues realisiert werden kann. Das ist für mich eines der strukturellen Probleme unserer gegenwärtigen Politik. Bei aller Freude an der wachsenden Bürgerbeteiligung, aber wenn die Verfahren gesetzlich und verfahrensmäßig so durchreglementiert werden, kann nichts Neues mehr passieren. Man müsste Räume schaffen, in denen die Reglements der Planungsverfahren außer Kraft gesetzt werden. Jetzt ist eine Zeit, wo man wieder für die Freiheit der Gedanken, für Experimentierfreiheit kämpfen müsste und Pionieren die Gelegenheit bieten sollte, ihre Dinge zu machen. Das ist eine politische Frage, die das Selbstverständnis der Gesellschaft im Kern trifft: Wie beweglich muss die Gesellschaft werden?
Wo könnten entsprechende Pionierfelder angesiedelt sein? Wo gibt es heute noch solche unkontrollierten Räume?
Wir müssen diese Räume aus der verwaltenden Kontrolle nehmen. Jungfräuliche Gebiete gibt es zwar nicht mehr, aber zu den zentralen Begriffen zählen die „New Frontiers“, wir hätten es dringend nötig, neue „New Frontiers“ zu bestimmen. Diese sind meiner Ansicht nach neue Formen des Bauens im Zusammenspiel mit neuen Formen des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens, die entwickelt und ausprobiert werden müssen, stellvertretend für das, was wahrscheinlich eintreten wird. Es geht um soziale und gebaute Formen, die zukünftigen Entwicklungen entsprechen. Das sind die neuen Abenteuerräume, die mit folgenden Fragen verbunden sind: Was bedeutet das Anthropozän, was bedeutet Ressourcenknappheit und wie kann man notwendige Begrenzungen kultivieren? Der Welt steht in den nächsten 50 Jahren eine gewaltige Urbanisierung bevor: Das Maximum der Erdbevölkerung wird in den folgenden fünf bis sieben Jahrzehnten auf über zehn Milliarden anwachsen, davon werden mindestens 70 Prozent in Städten leben. Das bedeutet eine Verdopplung der Städte, in einem Zeitraum, der unserem eigenen Planungshorizont entspricht. Das sind bevorstehende Entwicklungen.
Ungefähr 80 Prozent dieser Städte liegen in den gefährdeten Küstenregionen. Wie sieht denn die Arche Noah aus für die Stadt?
Das alte Dogma, dass Stadt im Gegensatz zur Natur steht, das Bild, das wir immer noch mit uns herumtragen von der steinernen Stadt im Gegensatz zu den grünen umgebenden Naturlandschaften, ist völlig überholt. Die stadtökologischen Forschungen seit den achtziger Jahren in Berlin zeigen, dass die Stadt viel artenreicher ist als das Umland mit der industrialisierten Landwirtschaft. Wolfgang Haber, inzwischen 92 Jahre alt, hat in dem Buch über „Die Welt im Anthropozän: Erkundungen im Spannungsfeld zwischen Ökologie und Humanität“ ausgeführt, es sei eine Illusion zu glauben, man könnte die Menschheit mit biologischer Landwirtschaft allein, ohne Gentechnik und Pestizide, ernähren. Wir müssen einen Kompromiss schließen zwischen der reinen Lehre der Ökologie und der Ernährungsmittelproduktion.
Auch in dieser Hinsicht ist unser Landschaftsbild komplett überholt. Das fand ich so spannend beim Wiederlesen der „Zwischenstadt“, vieles ist schon angedacht und man merkt nicht, dass dieses Buch zwanzig Jahre alt ist.
Eine ganze Reihe von schönen Begriffen ist inzwischen dazugekommen. Die Frage der Nahrungsmittelproduktion in Städten und die Rückzugsgebiete für die Natur sind meiner Meinung nach wichtig und bieten viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Idee ist anregend, Städte auch als Biotope zu lesen, die für Pflanzen und Tiere zusammen mit den Menschen bewohnbar sind.
Was könnten noch weitere Themen aus Ihrer Sicht sein?
Ein Riesenthema ist meiner Meinung nach das Zusammenleben der Generationen. Ich denke, dass bei dem steigenden Anteil alter und sehr alter Menschen die Möglichkeiten der Altenpflege – etwa über polnischen oder ukrainischen Pflegeimport – sehr begrenzt sind und dass wir unsere Alten auch nicht nach Thailand oder Australien auslagern können, wie man dies aus Japan berichtet. Auch die Bereitschaft der Gesellschaft, viel Geld auszugeben für einigermaßen gut bezahlte heimische Pflege, sehe ich nicht. Es geht praktisch um folgende Frage: Wie kann das Zusammenleben mit so vielen Alten und die sorgende Pflege in Zukunft human gelöst werden? Das ist auch ein städtebauliches Problem, nicht nur, aber auch ein Problem des Wohnungs- und Städtebaus, auch hier brauchen wir dringend Experimente.
Die Vorbilder sind alle Stereotypen institutionalisierten Charakters, die gleich aussehen…
Das darf nicht sein. Das kann sich keine Gesellschaft leisten. Wir müssen also Formen finden, wie wir sie bereits historisch in den Wiener Großsiedlungen der zwanziger Jahre ansatzweise hatten: Es müsste so etwas wie Pflegequartiere geben, wo man im Wohngebiet und in Verantwortung der Nachbarschaft die Alten und Kranken pflegen kann. Es müssen neue Wege gegangen werden, die politisch auch zu einer anderen Gesellschaft führen werden.
Ein weiteres Experimentierfeld praktischer Art sehe ich darin, dass wir auch im Wohnungsbau zu neuen Strukturen kommen müssen. Ich beobachte im Kleinen wie im Großen, dass fast nur noch im Teileigentum gebaut wird. Das macht verdichtete Wohnbaustrukturen fast unbeweglich, weil die gegensätzlichen Interessen und Vermögen die notwendigen Veränderungs- und Modernisierungsentscheidungen nahezu unmöglich machen. Wenn man in Teileigentum baut, was ich prinzipiell für vernünftig halte, dann müssten unsere Gebäude strukturell anders aussehen. Zum Beispiel sollte die Erschließung als langfristige, viel Primärenergie bindende, quasi kommunale Infrastruktur verstanden werden und die Wohnungen selbst als „Häuser“ in diese Infrastruktur eingefügt werden, die dann auch einzeln erneuerbar wären. Dieser Gedanke würde zu einer anderen Wohnungsarchitektur führen.
Wie werden aus diesen Ideen tragfähige Konzepte? Es ist schwierig, sich aus den festgefahrenen Vorstellungen und rechtlichen Rahmen zu befreien.
Wie schon gesagt, wir brauchen Experimentierräume, um bindende Vorschriften und Normen verlassen zu können, ohne dass das gleich zu Bestrafungen führt. Das ist ein gesellschaftspolitisches Grundsatzproblem: Wie hält sich eine Gesellschaft beweglich? Wie definiert sie ihre New Frontiers? Für mich wäre zum Beispiel die Frage der Integration der Alten und der Pflege eine New Frontier-Aufgabe. Es ist eine offene Frage, wie man so einen Experimentierraum definiert und wie man ihn in unser Rechtssystem einfügt. Es muss etwas passieren in dieser Richtung, sonst geht diese Gesellschaft in eine totale Erstarrung. Diese Art von Verkrustung, das Desinteresse fachlicher Art und am Zustand der Gesellschaft ist die Folge einer konservativ-reaktionären Grundstimmung. Es gibt nicht genug verantwortliche Leute, die den Mut haben, eingetretene Wege zu verlassen. Architekten sind mit ihren Entwurfsfähigkeiten eigentlich prädestiniert, mit Studierenden solche Versuche zumindest intellektuell zu wagen. Allein solche Diskussionen und die erforderlichen Experimente anzuregen und mit alternativen bildkräftigen Entwürfen zu belegen, in welche Richtung sie die Entwicklung der Städte führen könnten, halte ich für eine zentrale Aufgabe der Architekturfakultäten von heute.
Sollten wir nicht im nächsten Wintersemester in Darmstadt gemeinsam eine Aufgabe herausgeben?
Ich wäre sofort dabei!
Prof. Dr.-Ing. Annette Rudolph-Cleff studierte Architektur an der TH Karlsruhe und an der Ecole d´Architecture Paris-Belleville. Sie arbeitete nach dem Diplom (1991) bei Jean Nouvel in Paris und ab 1994 als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Karlsruhe, an der sie 1995 mit Auszeichnung ihre Promotion ablegte. Seit 1994 ist sie freiberuflich tätig. Nach einer Vertretungsprofessur an der Bergischen Universität Wuppertal wurde sie 2006 an das Fachgebiet Entwerfen und Stadtentwicklung der Technischen Universität Darmstadt berufen. Sie ist in verschiedenen Forschungsprojekten tätig und leitet als akademische Direktorin den internationalen Master-Studiengang „International Cooperation in Urban Development – Mundus Urbano“ sowie seit 2013 das europäische Team des Wettbewerbs „Designing Resilience in Asia“.